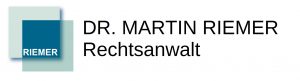Patient erhält Schmerzensgeld für fehlerhafte Fixierung und Zwangsbehandlung zugesprochen
In erster Instanz sprach das Landgericht Berlin dem Kläger im Urteil vom 28.01.2015, 86 O 88/14, aus einer rechtswidrigen Zwangsbehandlung Amtshaftungsansprüche in Höhe von 5.000 € zu.
In zweiter Instanz kam vor dem Kammergericht Berlin unter Abänderung des erstinstanzlichen Urteils ein Vergleich zustande, wonach der Kläger vom Beklagten 2.500 € zum Ausgleich aller Ansprüche im Zusammenhang mit dem Klinikaufenthalt erhält.
Der Sachverhalt
Ein verwirrter Mann wurde im Februar 2009 von Polizeibeamten abends vor seiner Wohnung, trotz der Kälte nur bekleidet in einem T-Shirt, aufgefunden. Sie brachten ihn in eine Klinik, wo von der diensthabenden Psychiaterin eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte und eine Einweisung angeordnet wurde. Als der Mann zum Wartebereich begleitet wurde, um auf die angeforderten Pfleger zu warten, ging er unvermittelt auf andere wartende Patienten und die eingesetzten Beamten los und versuchte, diese zu schlagen und zu treten. Hierbei rief er verwirrende Sätze. Daraufhin wurde eine Fesselung auf ein Krankenbett angeordnet. Hierbei leistete der Betroffene wiederum Widerstand. Nach 16 Stunden wurde der Patient defixiert.
Die Ärzte des sozialpsychiatrischen Dienstes stellten beim Amtsgericht einen Antrag auf Unterbringung für vier Wochen wegen einer akuten Psychose und einer Selbst- und Fremdgefährdung, woraufhin ein Sachverständiger zugezogen wurde. Dieser erklärte, dass der Betroffene an einer Exazerbation einer paranoiden Schizophrenie leidet und Verdacht auf halluzinatorisches Erleben bestehe. Er empfahl die Unterbringung für eine Dauer von vier Wochen. Daraufhin ordnete das Gericht eine Unterbringung des Mannes in eine geschlossene Einrichtung für diesen Zeitraum an.
Dort bekam er gegen seinen Willen 10 mg Haldol intravenös verabreicht, was zu starken Nebenwirkungen, wie einer andauernden starken Übelkeit und multiplen Krämpfen sowie Antriebs- und Konzentrationsmangel, führte. Auch erhielt er u.a. Solian, Akineton in Kombination mit Solian und Zyprexa, was zu Nebenwirkungen in Form von ständigem Umherlaufen, Tetanie, Krampfhaltung der Hand- und der Unterarmmuskulatur, Konzentrationsmangel, Stoffwechselstörungen mit Entzugserscheinungen bis hin zur absoluten Appetitlosigkeit geführt hat.
Der Zustand des Mannes besserte sich. Unter der Eindosierung von Amisulprid, welches der Patient widerwillig akzeptierte, kam es zu einem sukzessiven Rückgang der aggressiv-gereizten Symptomatik. Nach bereits einer Woche war eine Verlegung auf eine offen geführte Station problemlos möglich. Der Unterbringungsgrund entfiel und der Beschluss der Unterbringung wurde kurz vor der vorgesehenen Entlassung aufgehoben.
Der Kläger sagt, dass er weder sich noch andere gefährdet habe und durch die Einlieferung sein Grundrecht auf die körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 GG eingeschränkt worden und die Zwangsmedikation eine Körperverletzung sei.
Das Verwaltungsgericht Berlin verurteilte den Kläger zur Zahlung von Kosten für die Unterbringung in Höhe von 7.376,33 €.
Der Kläger verlangte 7.500 € Schmerzensgeld nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz und beantragte festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, ihm für alle gegenwärtigen und zukünftigen, noch aufgrund der Fehlbehandlung eintretenden Schäden Ersatz zu leisten hat.
Erste Instanz: Landgericht Berlin
Das Landgericht Berlin sprach dem Kläger im Urteil vom 28.01.2015, 86 O 88/14, aus einer rechtswidrigen Zwangsbehandlung Amtshaftungsansprüche in Höhe von 5.000 € zu.
Gründe für die Entscheidung:
- Ein Schadensersatzanspruch ist gegen den Beklagten aufgrund einer Amtspflichtverletzung zu richten und nicht gegen das Krankenhaus.
- Bei einer Zwangsbehandlung kommt nicht eine Haftung nach privatem Deliktsrecht, sondern ausschließlich nach den Grundsätzen der Amtshaftung in Betracht.
- Die Behandlung eines Patienten in einer geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Landeskrankenhauses ist öffentlich-rechtlicher Natur.
- Grundlage für Behandlungsfehler während der geschlossenen Unterbringung ist daher eine Amtshaftung nach Art. 34 GG, § 839 BGB.
- Die Fixierung muss nach § 29a des PsychKG (Berlin) befristet angeordnet werden und die besonderen Sicherungsmaßnahmen müssen ärztlich überwacht werden.
- Die Behandlung mit Medikamenten, die mit einer erheblichen Gefahr für die Gesundheit verbunden sind, dürfen nach § 30 Abs. 3 PsychKG zudem nur mit rechtswirksamer Einwilligung des Untergebrachten oder des gesetzlichen Vertreters vorgenommen werden.
- Die Gabe von Neuroleptika gegen den natürlichen Willen eines Patienten stellt einen besonders schweren Grundrechtseingriff auch im Hinblick auf die Wirkung dieser Medikamente dar. Dies gilt schon im Hinblick auf die nicht auszuschließenden lebensbedrohlichen Nebenwirkungen und die teilweise erhebliche Streuung in den Ergebnissen der Studie zur Häufigkeit des Auftretens erheblicher Nebenwirkungen.
- Die Verabreichung von Psychopharmaka gegen den natürlichen Willen des Betroffenen berührt unabhängig davon, ob sie mit körperlichem Zwang durchgesetzt wird, in besonderem Maße den Kern der Persönlichkeit, da Psychopharmaka auf die Veränderung seelischer Abläufe gerichtet sind.
- Jeder Amtsträger muss die zur Führung seines Amts notwendigen Rechtskenntnisse haben oder sich verschaffen.
Zweite Instanz: Kammergericht Berlin
Der Beklagte ging sodann in Berufung.
Die Parteien schlossen am 26.01.2016 auf Vorschlag des Kammergerichts Berlin einen Vergleich. Es erging die Entscheidung 9 U 35/15.
Der Vergleich
- Das Land Berlin erklärt gegenüber dem Kläger sein Bedauern für das Leiden, welches der Kläger während seiner Unterbringung aufgrund eines möglichen Fehlverhaltens der behandelnden Ärzte erlitten hat.
- Zum Ausgleich aller Ansprüche im Zusammenhang mit dem Klinikaufenthalt zahlt der Beklagte an den Kläger 2.500 €
- Von den Kosten der ersten Instanz haben der Kläger 2/3 und der Beklagte 1/3 zu tragen. Die Kosten der zweiten Instanz einschließlich des Vergleichs werden gegeneinander aufgehoben.
Stand: 30.03.2016