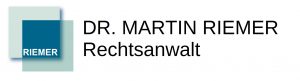Alles, was Sie zur Invaliditätsbescheinigung wissen müssen
Eine Invaliditätsbescheinigung stellt die dauerhafte unfallbedingte körperliche oder geistige Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit einer Person fest[1]. Sie wird immer dann erforderlich, wenn eine verunfallte Person ihre Invalidität bei ihrer Privaten Unfallversicherung geltend machen möchte, um Leistungen zu erhalten. Doch welche formellen und inhaltlichen Anforderungen sind an eine solche Bescheinigung zu stellen? Hierüber wird immer wieder gerichtlich gestritten. Die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen gerichtlichen Auseinandersetzungen haben wir hier für Sie zusammengefasst:
I. Voraussetzungen des Invaliditätsanspruchs
1. Vorliegen der Invalidität
Zunächst ist erforderlich, dass eine Invalidität bei der versicherten Person besteht. Dies ist der Fall, wenn die versicherte Person durch einen Unfall dauerhafte Schädigungen an ihrer Gesundheit erlitten hat[2].
2. Eintrittszeitpunkt der Invalidität
Die Invalidität der versicherten Person muss darüber hinaus innerhalb eines Jahres nach dem Unfallereignis eingetreten sein. Diese Jahresfrist ist eine die Entschädigungspflicht des Versicherers begrenzende Anspruchsvoraussetzung und somit zwingende Voraussetzung, von der nicht abgewichen werden kann[3]. Maßgeblich ist also, dass der Unfall zu einer Gesundheitsschädigung geführt hat, die innerhalb eines Jahres den Charakter einer lebenslänglich anhaltenden Dauerschädigung erlangt hat.[4]
3. Fristgerechte ärztliche Feststellung der Invalidität
Außerdem muss die Invalidität auch fristgerecht ärztlich festgestellt werden.
Für die ärztliche Feststellung wird eine Frist von 15 Monaten seit dem Unfallereignis gewährt, wobei auch hier wie schon bei der Jahresfrist gilt, dass es sich um eine die Entschädigungspflicht des Versicherers begrenzende Anspruchsvoraussetzung handelt, deren Nichteinhaltung nicht entschuldigt werden kann[5]. Sie dient einerseits der Ausgrenzung von Spätschäden und andererseits der schnellen Klärung der Einstandspflicht des Versicherers.[6] Wichtig ist, dass das Fehlen einer fristgerechten ärztlichen Feststellung auch dann nicht übergangen werden kann, wenn den Versicherungsnehmer kein Verschulden an der Nichteinhaltung der Frist trifft.[7] Dies liegt mitunter daran, dass ein Vorliegen von Anspruchsvoraussetzungen nicht über die Grundsätze von Treu und Glauben simuliert werden kann.[8] Das kann wie 2011 in einem vor dem LG Dortmund verhandelten Fall dazu führen, dass selbst bei ärztlichem Verschulden, etwa bei von Ärzten innerhalb der Frist nicht erkannten Schäden, das Fehlen der Anspruchsvoraussetzung trotzdem zu berücksichtigen ist.[9] Ausnahmsweise kann es aber zulässig sein, die Feststellung nach Ablauf der 15 Monate erst einzureichen. Dies kann der Fall sein, wenn der Versicherer seiner Hinweispflicht aus § 186 VVG nicht nachgekommen und sich somit auf ein Verstreichen der Frist nicht berufen kann.[10] Eine weitere Ausnahme ergibt sich aus dem Vertrauensschutz des Versicherungsnehmers: Durfte er aufgrund des Verhaltens des Versicherers darauf vertrauen, dass dieser von sich aus für eine rechtzeitige ärztliche Feststellung sorgen werde, so kann der Versicherer sich nicht auf den Fristablauf berufen.[11]
Außerdem muss die ärztliche Feststellung schriftlich oder jedenfalls elektronisch erfolgen. Dies ergibt sich aus dem Sinn und Zweck der Regelung, unabhängig davon, ob die AUB Schriftlichkeit ausdrücklich fordern, denn es soll grade eine unabhängig von möglichen Spätfolgen innerhalb des 15 Monat Zeitraums eingetretene Invalidität festgestellt werden.[12] Bei einer bloßen späteren mündlichen Wiedergabe einer Feststellung, die nicht schriftlich erfolgt ist, wäre der Arzt durch Erkenntnisse über den weiteren Gesundheitsverlauf der versicherten Person, die er möglicherweise erlangen könnte, beeinflusst, so dass Beweisschwierigkeiten bestünden. Zudem wäre das Fristerfordernis dann überflüssig, denn nur die Aussage des Arztes, aber keine anderen Tatsachen, die eine fristgerecht eingetretene Invalidität und Feststellung dieser belegen würden, wären existent.[13] Zusätzlich ist maßgeblich, dass die Regelung bezüglich der ärztlichen Feststellung für den durchschnittlichen Versicherungsnehmer grade so zu verstehen ist, dass eine schriftliche Feststellung erforderlich ist, weil er sie als Teil der Anspruchsvoraussetzung erkennt.[14] Schließlich geht auch der BGH von einer Schriftlichkeit aus, indem er von einer „Invaliditätsbescheinigung“ und nicht von einer bloßen Feststellung spricht.[15] Die Feststellung braucht allerdings nicht in einem eigenen Dokument enthalten sein, auch in einer elektronischen Datei eines Arztes enthaltene Feststellungen genügen, solange sie den übrigen inhaltlichen Anforderungen entspricht.[16] Diese dürfen aber selbstverständlich nicht nach Fristablauf erst zugefügt werden.[17]
Des Weiteren muss die Bescheinigung durch einen Arzt erstellt werden. Ein Neuropsychologe ist insbesondere kein Arzt[18], das gleiche wird auch für Heilpraktiker oder Apotheker gelten müssen. Es muss sich jedoch nicht um einen Facharzt handeln, jeder Arzt darf die Invalidität feststellen.[19] Es muss sich aber um einen neutralen und unbeteiligten Arzt handeln, d.h. eine versicherte Person, die selbst Arzt ist, kann sich nicht einfach selbst eine Invaliditätsbescheinigung ausstellen.[20]
Die ärztliche Feststellung der Invalidität kann in einigen Fällen auch entbehrlich sein. Dies ist der Fall, wenn aus ärztlichen Befunden zwingend auf einen Dauerschaden zu schließen ist, etwa bei dem unfallbedingten Verlust von Körperteilen und Gliedmaßen oder Querschnittslähmungen und anderen schwerwiegenden Behinderungen.[21] Nicht ausreichend sind aber das Vorlegen eines Bescheids des Versorgungsamtes über den Grad der Behinderung oder ärztliche Atteste zur Minderung der Erwerbstätigkeit.[22]
4. Fristgerechte Geltendmachung der Invalidität beim Versicherer
Schließlich muss die Invalidität auch fristgerecht beim Versicherer geltend gemacht werden.
Hierzu hat die versicherte Person erneut 15 Monate ab dem Unfall Zeit.[23] Anders als zuvor handelt es sich bei dieser Frist aber um eine Ausschlussfrist, so dass bei Fristverstreichen Entschuldigungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen sind.[24] Sollten solche vorliegen, muss der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person die Invalidität nach Wegfall des Entschuldigungsgrundes dem Versicherer unverzüglich melden; eine neue Frist beginnt nicht.[25]
Zur Geltendmachung der Invalidität hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer gegenüber lediglich schriftlich zu behaupten, dass Invalidität eingetreten ist.[26]
Wichtig ist noch, dass die ärztliche Invaliditätsfeststellung anders als die Geltendmachung dem Versicherer nicht innerhalb der 15-Monatsfrist zugehen muss.[27]
II. Inhaltliche Anforderungen an die Invaliditätsbescheinigung
Neben den formalen Erfordernissen bestehen auch inhaltliche Anforderungen, denen die Invaliditätsbescheinigung genügen muss.
Zu aller erst muss klar festgestellt werden, dass Invalidität innerhalb eines Jahres eingetreten ist. Hierbei genügen etwaige Feststellungen, die auf ein wahrscheinliches oder mögliches Eintreten lauten, grundsätzlich nicht, wenn klar ist, dass eine zukünftige Nachuntersuchung noch erfolgen soll.[28] Wenn Formulierungen wie „wahrscheinlich“ aber verwendet werden und sich aus dem Kontext ergibt, dass sie lediglich den Prognosecharakter der Feststellung unterstreichen, so sind sie unschädlich.[29] Außerdem müssen in der Invaliditätsbescheinigung alle invaliditätsbegründenden Dauerschäden genannt sein, d.h. alle Symptome, Diagnosen und Krankheitsbilder, auf welche die Invalidität gestützt wird.[30] Nur die in der Invaliditätsbescheinigung genannten Dauerschäden können für den Anspruch auf Invaliditätsleistungen in Betracht kommen.[31]
Der Arzt muss in der Invaliditätsbescheinigung Angaben zu der Schädigung sowie deren Auswirkung und zu den Ursachen der Invalidität und der Art ihrer Auswirkungen machen.[32] Außerdem muss er eindeutig feststellen, dass das Unfallereignis für die Invalidität kausal ist.[33] Hingegen nicht erforderlich ist das Nennen eines bestimmten Invaliditätsgrades.[34] Es ist unschädlich, wenn die Feststellungen sich später als unzutreffend herausstellen sollten.[35]
III. Empfehlung
Wenn Sie glauben, dass Sie einen Invaliditätsanspruch haben könnten, dann ist es besonders wichtig, diesen schnell zu prüfen um die verschiedenen Fristen zu wahren. Um sicher zu stellen, dass Sie allen Anforderungen genügen, können Sie sich zunächst an diesem Beitrag orientieren. Wenn Sie aber weitere Fragen haben sollten oder der Meinung sind, dass Ihr persönlicher Fall komplizierter ist, oder wenn Sie sich bereits im Streit mit ihrer Versicherung befinden, dann können Sie sich gerne vertrauensvoll an die Kanzlei Dr. Martin Riemer wenden. Hier helfen wir Ihnen mit langjähriger Erfahrung im Versicherungsrecht und finden mit Ihnen gemeinsam die beste Lösung für ihr Problem.
[1] Matthias Schneil in: Weber, Rechtswörterbuch, 33. Edition 2024
[2] OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. März 1990 – 4 U 146/89
[3] BGH Urt. v. 28.6.1978 – IV ZR 7/77, IBRRS 1978, 0001
[4] Kloth in: Kloth PUV, 2. Aufl. 2014, 2. Rn. 19
[5] BGH Urt. v. 28.6.1978 – IV ZR 7/77, IBRRS 1978, 0001
[6] Kloth in: Kloth PUV, 2. Aufl. 2014, 3. Rn. 24
[7] BGH, Urteil vom 7. 3. 2007 – IV ZR 137/06 (OLG Karlsruhe)
[8] Kloth in: Kloth PUV, 2. Aufl. 2014, 3. Rn. 49.
[9] LG Dortmund, Urteil vom 13. 1. 2011 – 2 O 325/10
[10] Kloth in: Kloth PUV, 2. Aufl. 2014, 3. Rn. 49.
[11] OLG Karlsruhe, Urteil v. 24.10.2014 – 9 U 3/13
[12] Kloth in: Kloth PUV, 2. Aufl. 2014, 3. Rn. 25
[13] Kloth in: Kloth PUV, 2. Aufl. 2014, 3. Rn. 26, OLG Hamm, Urteil vom 26. 10. 2011 – I-20 U 162/10
[14] Kloth in: Kloth PUV, 2. Aufl. 2014, 3. Rn. 27.
[15] BGH, Urteil vom 7. 3. 2007 – IV ZR 137/06 (OLG Karlsruhe)
[16] Rixecker in: Langheid/Rixecker/, 7. Aufl. 2022, VVG § 186 Rn. 6
[17] Rixecker in: Langheid/Rixecker/, 7. Aufl. 2022, VVG § 186 Rn. 6
[18] OLG Koblenz, Urteil vom 18. 11. 2011 – 10 U 230/11
[19] Piontek in: Prölss/Martin, 32. Aufl. 2024, AUB 2020 0.2 Rn. 15
[20] OLG Koblenz, Urteil vom 19. 2. 1999 – 10 U 1912/97
[21] Piontek in: Prölss/Martin, 32. Aufl. 2024, AUB 2020 0.2 Rn. 17
[22] Kloth in: Kloth PUV, 2. Aufl. 2014, 3. Rn. 45
[23] Piontek in: Prölss/Martin, 32. Aufl. 2024, AUB 2020 0.2 Rn. 19
[24] Kloth in: Kloth PUV, 2. Aufl. 2014, 4. Rn. 51
[25] OLG Frankfurt/M., Urt. v. 20. 11. 2013 – 7 U 176/11
[26] BGH, Urteil vom 25-04-1990 – IV ZR 28/89 (Hamm)
[27] Kloth in: Kloth PUV, 2. Aufl. 2014, 3. Rn. 47
[28] Kloth in: Kloth PUV, 2. Aufl. 2014, 3. Rn. 37f, Piontek in: Prölss/Martin, 32. Aufl. 2024, AUB 2020 0.2 Rn. 15
[29] OLG Bremen (3. Zivilsenat), Urteil vom 09.06.2016 – 3 U 23/14
[30] BGH, Urteil vom 7. 3. 2007 – IV ZR 137/06 (OLG Karlsruhe)
[31] BGH, Urteil vom 7. 3. 2007 – IV ZR 137/06 (OLG Karlsruhe)
[32] BGH, Urteil vom 1.4.2015 – IV ZR 104/13; Kloth in: Kloth PUV, 2. Aufl. 2014, 3. Rn. 42
[33] Kloth in: Kloth PUV, 2. Aufl. 2014, 3. Rn. 43; auch: OLG Dresden Beschl. V. 5.1.2021 – 4 U 1586/20, BeckRS 2021, 882
[34] BGH, Urteil vom 06.11.1996 – IV ZR 215/95 (Frankfurt a.M.)
[35] Rixecker in: Langheid/Rixecker, 7. Aufl. 2022, VVG § 186 Rn. 7
So erreichen Sie unsere Kanzlei in Köln:
Rechtsanwalt Dr. Martin Riemer
Fachanwalt für Medizinrecht und Versicherungsrecht