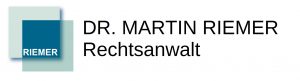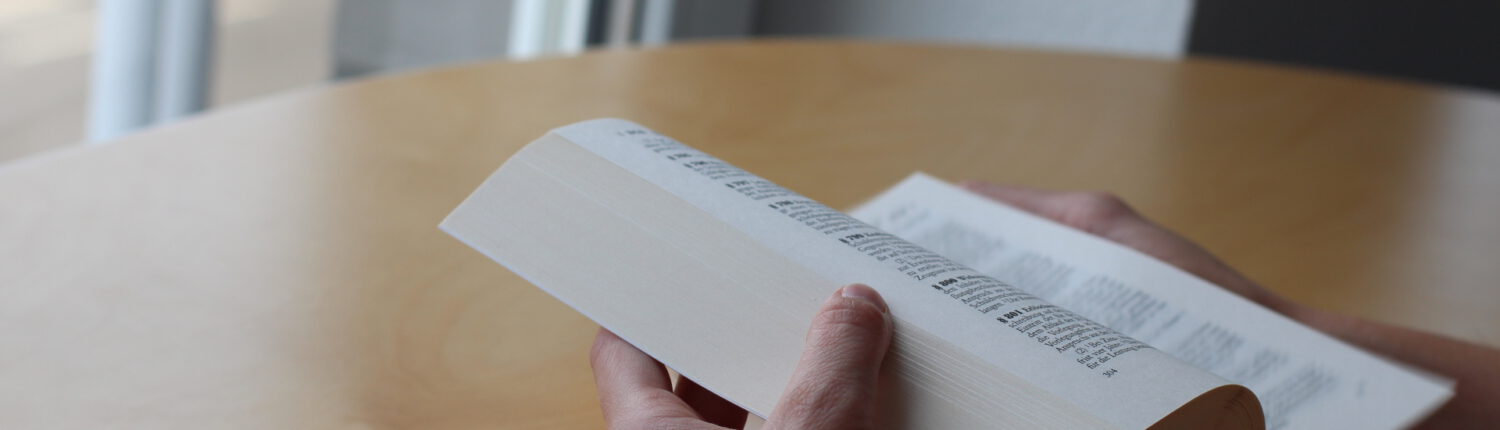Gesetz und Recht i.S.d. Art. 20 Abs. 3 GG – nur eine Tautologie?
Einleitung
Durch Art. 20 Abs. 3 GG wird die Legislative an die verfassungsgemäße Ordnung gebunden und Exekutive und Judikative werden zur Wahrung von Gesetz und Recht verpflichtet. Das hieraus resultierende Rechtsstaatsprinzip soll die Freiheit der Bürger sichern, indem es dem Staat untersagt wird, beliebig, sprich ohne gesetzliche Grundlage, in die Rechte der Bürger einzugreifen.
Die Formulierung „Gesetz und Recht“ geht historisch betrachtet auf Verfassungen des 19. Jahrhunderts zurück, die jedoch meist keine Differenzierung zwischen diesen beiden Begriffen vornahmen, sondern ihr Hauptaugenmerk lediglich auf das positive Verfassungsrecht und nicht auf das Recht i.S.d. Gewohnheitsrechts, legten. Nur selten unterschied man zwischen Gesetz und Recht, aber schon im Zuge der Weimarer Reichsverfassung (1919-1933) kam dem Begriff des Rechts keinerlei Bedeutung mehr zu. Die Aufnahme des Begriffspaares „Gesetz und Recht“ in das Grundgesetz geschah nicht aus dem Grund eine vergangene Tradition fortzuführen, sondern infolge der Geschehnisse der Zeit des Nationalsozialismus. Ziel war es dadurch zu verdeutlichen, dass Gesetz und Recht nicht zwangsläufig eine Tautologie sind, sondern auch auseinanderfallen können, wenn das geschriebene Gesetz dem Gerechtigkeitsempfinden wiederspricht.
Wie wird der Begriff des Gesetzes in Art. 20 Abs. 3 GG verstanden?
Um sich die Unterschiede zwischen Gesetz und Recht bewusst zu machen, muss man erst einmal verstehen, was mit dem Begriff des Gesetzes i.S.d. Art. 20 Abs. 3 GG gemeint ist.
Staaten halten allgemeingültige Verhaltensregeln in Textform fest, wodurch sie für jedermann erkennbar und verpflichtend sind. Wenn diese geschriebenen Rechtsnormen vom Parlament in einem ordnungsgemäßen Verfahren verabschiedet wurden sind, spricht man von Gesetzen im formellen Sinn, welche nach herrschender Meinung von Art. 20 Abs. 3 GG erfasst sind. Sie unterscheiden sich von materiellen Gesetzen dadurch, dass sie im Gegensatz zu letztgenannten nicht jegliche abstrakt-generelle Regelungen sein können, unbeachtlich dessen, ob sie durch das Parlament oder durch die Exekutive erlassen wurden sind. Außerdem umfasst der Begriff des Gesetzes auch die Verfassungsbestimmungen, nach Art. 59 Abs. 2 GG transformiertes Völkervertragsrecht, zu dem unter anderem die EMRK zählt, und unmittelbar anwendbares EU-Recht.
Hingegen meint der Gesetzesbegriff nicht das Richterrecht, aufgrund dessen, dass es auf richterlicher Auslegung und Rechtsfortbildung fußt und mithin ein Ergebnis rechtsgebundener Richtertätigkeiten ist. Nichts desto trotz muss die Verwaltung die Entscheidungen der Gerichte, insbesondere die des Bundesverfassungsgerichts achten, da eine Missachtung der Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts als ein Verstoß gegen Art. 20 Abs. 3 GG gewertet wird. Ebenso stellen exekutiv geschaffene Normen, die lediglich im Verwaltungsbinnenbereich Bindungskraft besitzen, wie Verwaltungsvorschriften, kein Gesetz i.S.d. Art. 20 Abs. 3 GG dar. Begründet wird dies dadurch, dass solche Normen nur Gegenstand, aber nicht Maßstab, der Überprüfung des Verwaltungshandelns sein können.
Uneinigkeit besteht allerdings bis heute darüber, ob Normen, die zwar durch die Exekutive geschaffen wurden sind, aber unmittelbare Außenwirkung gegenüber den Bürgern haben, wie beispielsweise Rechtsverordnungen oder Satzungen, unter den Begriff des Gesetzes fallen. Eine Literaturansicht verneint dies, da Art. 20 Abs. 3 GG eine Abstufung enthält: Der Gesetzgeber ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden und auf der nachfolgenden Stufe sind die Exekutive und Judikative an (formelle) Gesetze gebunden. Des Weiteren handele es sich bei Rechtsverordnungen und Satzungen um eine Schöpfung der Exekutive, welche aber einen durch Art. 20 Abs. 3 GG gebundener Adressaten darstellt, sodass nur eine Bindung an höherrangige Normen, sprich formelle Gesetze, in infrage komme. Jedoch hält dem die Gegenauffassung entgegen, dass dies im Widerspruch zum Zweck der Gesetzesbindung des Art. 20 Abs. 3 GG steht. Ziel sei es, das Handeln der staatlichen Organe an Normen zu binden, sodass auf diese Weise die Rechtsstaatlichkeit und –förmigkeit ihrer Akte gewährleistet wird und für die Bürger ein staatliches Verhalten vorhersehbar ist. Diese Zwecksetzung kann auch bei Normen, die durch die Exekutive geschaffen worden sind, erreicht werden, ungeachtet dessen, dass sie nicht am Vorrang des Gesetzes teilhaben, da auch sie Bindungs- und Rangwirkung entfalten können.
„Recht gebietet, Gerechtigkeit zu realisieren“
Nicht immer erscheinen positive Gesetz für die Menschen auch wirklich gerecht, sodass es Einigen so vorkommen wird, als müsste die Gerechtigkeit nicht immer bei staatlichen Akten beachtet werden. Doch sind Gerechtigkeitsvorstellungen tatsächlich nicht in der Verfassung verankert?
Die wohl herrschende Meinung definiert den Begriff des Rechts i.S.d. Art. 20 Abs. 3 GG als eine Vielzahl an verbindlichen Verhaltensregeln, die in dem Interesse eines menschlichen Beisammenseins und bewährten Rechtserfahrungen verwurzelt sind und demzufolge auf materielle Gerechtigkeit ausgerichtet sind. Dadurch wird das Gewohnheitsrecht verfassungsrechtlich anerkannt und fundamentale Prinzipien der Rechtsordnung werden angesprochen, die ihre Wirksamkeit bei der richterlichen Rechtsfortbildung entfalten können. Dadurch seien Exekutive und Judikative nicht nur den geschriebenen, formellen Gesetzen verpflichtet, sondern auch an Gerechtigkeitsprinzipien gegenüber den Bürgern gebunden, die aus moralischen und sittlichen Geboten hervorgehen. Resultierend daraus wird nicht nur die Legalitätsfrage, sondern auch die Legitimitätsfrage in der Verfassung thematisiert. Sinn und Zweck dieser Formulierung sei es, dass das formelle Gesetz nicht unbeachtlich von Gerechtigkeitsansprüchen bestehen solle. Mithin gebietet nach dieser Auffassung Recht, Gerechtigkeit zu verwirklichen.
Hingegen wird auch vertreten, dass der Begriff des Rechts i.S.d. Art. 20 Abs. 3 GG als ein Hinweis auf die gesamte verfassungsgemäße Ordnung zu verstehen sei. Dadurch wären Exekutive und Judikative vorrangig dem Grundgesetz, sowie untergesetzlichen Nomen, verpflichtet. Nachrangig wären sie aber auch an das Gewohnheitsrecht und infolgedessen an Gerechtigkeitsvorstellungen gebunden. Somit schließt auch nach dieser Ansicht der Begriff des Rechts die Gerechtigkeit mit ein.
Eine in der Literatur vertretene Gegenauffassung wiederspricht diesen Verständnissen. Sie bringt vor, dass wenn der Verfassungsgeber die Gefahr von Gesetzen, die dem Gerechtigkeitsempfinden wiedersprechen, hätte verhindern wollen, er nicht nur Exekutive und Judikative, sondern auch die Legislative, ausdrücklich an die Gerechtigkeit gebunden hätte, sodass es gar nicht erst zu einem Konflikt zwischen Gesetzen und Gerechtigkeit kommen könne. Darüber hinaus werde verkannt, dass die Gerechtigkeitsidee bereits in der Verfassung durch verschiedene Vorschriften verankert sei, sodass eine Einbringung von Gerechtigkeitsprinzipien durch Art. 20 Abs. 3 GG nicht allein deshalb notwendig sei, weil man fürchte, dass traditionelle Gerechtigkeitsgrundsätze nicht Bestandteil der Verfassung sein könnten, wenn man „Recht“ nicht als Gerechtigkeit verstehe. Verwiesen sei auf die Menschenwürde des Art. 1 Abs. 1 GG, sowie auf den allgemeinen Gleichheitssatz in Art. 3 Abs. 1 GG, durch welche die materielle Seite der Rechtsstaatlichkeit in der Verfassung verankert wird und zwar nicht nur als eine abstrakte Gerechtigkeit. Schließlich führe diese Auslegung des Rechtsbegriffs dazu, dass die sonst so strenge Normativität der Verfassungsordnung aufgeweicht werden würde, indem eine Bindung an das Gerechtigkeitsempfinden zum Einfallstor für Vorstellungen, die der im Grundgesetz konstituierten Wertordnung entgegenstehen, werden könnte. Infolgedessen sei es geboten, die Gerechtigkeit als bereits in der grundgesetzlichen Wertordnung verkörpert zu sehen, sodass demgemäß der Rechtsbegriff eine rhetorische Figur, die lediglich eine inhaltliche Wiederholung des Gesetzesbegriffs darstelle, sei. Jedoch überzeugt diese Ansicht nicht, denn es lässt sich aufgrund des ausdrücklichen Wortlautes nicht leugnen, dass der Gesetzes- und Rechtsbegriff des Art. 20 Abs. 3 GG einander sprachlich und inhaltlich unterscheiden und mithin zuletzt genannter als eine Ausformung von grundsätzlichen Gerechtigkeitsvorstellungen auszulegen ist.
Nur ein Appell oder sogar rechtsdogmatische Bindungswirkung?
Folgt man den Ansichten, welche in Art. 20 Abs. 3 GG durch den Rechtsbegriff die Gerechtigkeit statuiert sehen, dann stellt sich die Frage, ob und in welchem Umfang der Staat dem überpositiven Recht verpflichtet ist, insbesondere dann, wenn dies im Konflikt zum formellen Gesetz steht. Deren Beantwortung bereitet jedoch Schwierigkeiten, infolgedessen es nicht „die eine Antwort“ gibt, sondern verschiedene Lösungsversuche.
Zum Teil wird vertreten, dass das ungeschriebene Recht neben dem formellen Gesetz besteht. Hingegen solle nach einer anderen Auffassung zwischen Gerechtigkeit und Gesetz kein Nebeneinander gegeben sein, sondern letztgenannte müsse weichen, wenn ein nicht auszuhaltender Widerspruch zwischen dem positiven Recht und der Gerechtigkeit besteht (Radbrusche Formel), da die Gesetzesbindung unter dem Vorbehalt des Einklangs von Gesetz und Gerechtigkeit stehe, denn die Gerechtigkeit solle stets das Handeln der Exekutive leiten. Zuletzt wäre es denkbar, dass der Gerechtigkeit keine eigenständige rechtliche Bedeutung zukommt, sondern sie immer hinter das geschriebene Recht zurücktreten muss und sie somit nur einen appellativen Charakter hat.
Zu beachten ist bei der Klärung der Frage, dass lediglich formelle Gesetze imstande sind, staatlichen Akten Legitimität zu verleihen. Diese Idee entspringt einem demokratischen Grundverständnis, nach welchem in einem liberal-demokratischen Rechtsstaat Gerechtigkeitskonflikte vom Parlament zu lösen sind. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, dass das Recht, im Sinne von Gerechtigkeit, eine rechtsdogmatische Bindungswirkung gegenüber Verwaltung und Rechtsprechung entfaltet. Ansonsten könnten sich einzelne Bürger, unter Berufung auf die Gerechtigkeit, sowie deren Bindungswirkung für Exekutive und Judikative, dem Geltungsanspruch des geschriebenen Rechts entziehen, wodurch die Wertungen der Legislative und die verfassungsrechtliche Rechtsordnung durch individuelle Auffassungen von Gerechtigkeit ersetzt, das Grundgesetz damit einhergehend seine demokratische Legitimationsgrundlage verlieren und das Gewaltmonopol des Staates umgangen werden würde. Aber auch der Staat könnte sich sonst unter Verweis auf seine individuellen Gerechtigkeitsvorstellungen der Bindungskraft der Gesetze entziehen. Um dies zu vermeiden, sollen Fragen der Gerechtigkeit allein dem Gesetzgeber überlassen bleiben und nicht durch eigenes Gerechtigkeitsempfinden ersetzt werden können. Dementsprechend ist der Rechtsbegriff vielmehr als ein moralischer Appell zu verstehen, bei staatlichen Handlungen sich stets unterschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen bewusst zu machen und zu beachten.
Fazit: Die Versöhnung von Gesetz und Recht im Grundgesetz
Nicht immer entspricht das gesetzte Recht dem Gerechtigkeitsdenken der Menschen. Doch indem Gerechtigkeitsproblematiken von der Stufe des überpositiven Rechts, das lediglich eine Vorstellung der Gerechtigkeit ist, auf die Ebene des geschriebenen Rechts, welches aus den Vorstellungen hinreichend bestimmte Normen verfasst, gezogen werden, sind durch diesen Prozess meist Gesetz und Recht identisch, da zentrale Gerechtigkeitsgesichtspunkte meist verbindlich normiert werden. Mithin sind Konflikte zwischen positiven Gesetzen und Gerechtigkeitsvorstellungen zwar durchaus möglich, aber schwer denkbar. Nichts desto trotz ist die Staatsgewalt gem. Art. 20 Abs. 3 GG nur den formellen Gesetzen verpflichtet und soll die Bindung an das Recht, sprich an Gerechtigkeitsprinzipien, nur als Appell verstehen.
Erstellt am 09.04.2021
So erreichen Sie unsere Kanzlei in Köln:
Rechtsanwalt Dr. Martin Riemer
Fachanwalt für Medizinrecht und Versicherungsrecht