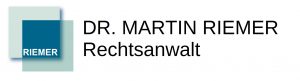Hat ein Patient einen Anspruch auf lesbare Behandlungsunterlagen gegen den Arzt?
I. Einführung
Die Frage nach den Rechten des Patienten im Rahmen eines Behandlungsvertrags stellt sich immer häufig vor. Im Vordergrund rückt sich insbesondere die Frage ein, ob der Patient einen Anspruch auf lesbare Behandlungsunterlagen gegen den Arzt haben kann. Welche Rechtsgrundlage dieser Anspruch hat, ob er überhaupt zu gewähren ist und welche Rechte dessen Geltendmachung entgegenstehen, werden im Folgenden erörtert.
II. Entscheidende Normen
§ 630g Abs.1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) regelt das Einsichtsrecht des Patienten in den ihn betreffende Patientenakte. Diese Norm dient der Verwirklichung seines Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, das eine Ausprägung des grundrechtlich gewährleisteten Allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Art. 2 Abs.1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) darstellt[1]. Sie verpflichtet den Behandelnden zur Gewährung der Einsicht in die „vollständige“ Patientenakte. Das sind medizinische, objektivierbare Befunde und Berichte über die Behandlungsmaßnahmen wie Operationen und Medikationen sowie die Schilderung subjektiver Wahrnehmungen und persönlicher Eindrücke des Behandelnden. [2]
Auch wenn dem Patienten ein vollständiges Einsichtsrecht gewährt wird, wird damit noch nicht zum Ausdruck gebracht, in welcher Form dieses Einsichtsrecht zu erteilen ist. Dafür sieht § 630 Abs.2 BGB vor, dass der Patient „auch elektronische Abschriften von der Patientenakte verlangen“ kann. Dies deutet darauf hin, dass eine elektronische Erteilung von Behandlungsunterlagen nur subsidiär gegenüber einer schriftlichen und physikalischen Auskunft darstellt.
Allerdings hilft dies dem Patienten oft nicht weiter, wenn er versucht, die Unterlagen selbst zu lesen und nachvollzuziehen. Dies ergibt sich zum einen daraus, dass ein Arzt bekanntermaßen sehr schwer lesbare Handschrift hat und zum anderen daraus, dass das Geschriebene oft mit Abkürzungen, lateinischen Worten und Kürzeln versehen ist.
III. Der grundlegende Sachverhalt und Kernaussagen der Gerichte
Dieses Problem war der Auslöser der vor Landgericht Marburg verfassten Entscheidung von 30.06.2003, wonach die Klägerin einen Anspruch auf nachvollziehbare Behandlungsunterlagen in Form des Auskunftsanspruchs gegen die Beklagte – das Uniklinikum Marburg – im Namen ihres aufgrund der Behandlung verstorbenen Ehemanns geltend gemacht hat. Das Landgericht Marburg und später der Beschluss des Oberlandesgerichts Frankfurt von 03.09.2003 haben im Wesentlichen einheitliche Meinung dazu. Im Folgenden werden die Kernargumente der beiden Gerichte kurz dargestellt.
1. Erteilung einer Auskunft in einer für die Laien verständlichen Sprache
Der früher auf §§ 611, 1922, 242 BGB gestützte Auskunftsanspruch der Klägerin, der nunmehr vorrangig von § 630g Abs.2 BGB erfasst ist, bezog sich darauf, sämtliche Behandlungsunterlagen ihres aufgrund einer fehlgegangenen Behandlung verstorbenen Ehemanns in einer ins Deutsch zu übersetzenden, von Abkürzungen befreiten und für einen medizinischen Laien verständlichen Sprache zu erhalten. Die Klägerin machte den Anspruch gegen das Uniklinikum geltend.
Nach Auffassung des Landgerichts besteht ein so weitgehender Auskunftsanspruch nicht. Dies wird damit begründet, dass die Sprache, die bei solchen Unterlagen am meisten verwendet wird, oft Fachbegriffe auf Latein enthält, die unter den Medizinern weltweit als Standard gilt. Ein medizinischer Laie wird zudem vor jeder Behandlungsmaßnahme bereits von seinem Arzt unterrichtet, wie sie durchzuführen ist und welche mögliche Konsequenzen sie auf seine Gesundheit und Genesung hat.
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Patient nach der Behandlung immer eine Fachperson beauftragen kann, damit sie ihm die fremden lateinischen Fachausdrücke und Fachbegriffe erklärt.
Zwar wäre es denkbar, dass solche Unterlagen aufgrund der Vorbereitung eines Amtshaftungsprozesses in deutsche Sprache übersetzt werden müssen. Allerdings ist bei einem Haftpflichtprozess nicht die Übersetzung von Fachbegriffen von zentraler Bedeutung, sondern vielmehr die Behandlung und die Stellung der richtigen Diagnose selbst sowie die Auswertung der Behandlungsmaßnahmen, die zum Erfolg oder Misserfolg geführt haben.
Aus diesen Gründen ist es nicht erforderlich, dass der oder die Behandelnde selbst eine laienfreundliche Sprache bei der erstmaligen Abfassung der Behandlungsunterlagen verwendet. Dies würde zu unnötig höherem Zeitaufwand führen, der in weiteren, wichtigeren Aufgaben investiert werden kann.
2. Erteilung einer lesbaren Abschrift
Darüber hinaus machte die Klägerin geltend, dass die Unterlagen in lesbarer Form und ohne Abkürzungen oder Kürzeln abgefasst werden. Nach Ansicht beider Gerichte besteht dieser Anspruch allerdings nicht.
Der Grund dafür ist, dass bei handschriftlichen Behandlungsunterlagen die Verwendung von Abkürzungen und Kürzeln gebräuchlich und allgemein anerkannt ist.
Die Grenze wird erst dort erreicht, wo die Abkürzungen und die Kürzel in keinem Zusammengang stehen und selbst Ärzte diese nicht verstehen können. Nur in diesen oder ähnlich gelagerten Fällen könnte sich dann ein weiterer Anspruch auf lesbare Abschriften ergeben.
Zwar könnte man entgegnen, dass ärztliche Behandlungsunterlagen genauso wie eine Packungsbeilage nach dem Arzneimittelgesetz (AMG) abgefasst werden müssen. Eine Packungsbeilgage und eine ärztliche Diagnose sind indes nicht vergleichbar. Eine Packungsbeilage muss aufgrund der Funktionen, die ihr zukommen – nämlich Hinweis-, Warn- und Aufklärungsfunktion, so genau und verständlich abgetippt sein wie möglich. Der Grund dafür ist, dass die Einnahme von Medikamenten aus der Apotheke vollständig den Patienten selbst überlassen wird ohne weitere ärztliche Kontrolle. Damit bezweckt eine Packungsbeilage, auf die Risiken und Gefahren bei übermäßiger Einnahme des jeweiligen Medikaments hinweisen.
Auf der anderen Seite dienen ärztliche Befunde und Berichte nicht dem Patienten, sondern den Medizinern. Insbesondere ist dies der Fall, wenn ein Patient seine Heilbehandlung an unterschiedlichen Krankenhäusern und bei unterschiedlichen Ärzten durchführen muss. Die Ärzte müssen dadurch in Kenntnis versetzt werden, welche Heileingriffe der Patient bis zum aktuellen Zeitpunkt unterlaufen hat und was noch zu machen ist.
Wiederum kann man an diese Stelle dagegen anführen, diese Unterlagen seien genauso wichtig für einen Amtshaftungsprozess. Wie bereits erwähnt fällt dieser Umstand weniger ins Gewicht, denn bei der Vorbereitung dieses Prozesses noch weitere Fachpersonen und Sachverständigen eingeschaltet werden können, die die Unterlagen ohne viel Aufwand ablesen und elektronisch eintippen können. Dies kann der eigene Arzt sein, muss es aber nicht, denn ärztliche Dokumente über einen Patienten dienen vorrangig der internen Kommunikation der behandelnden Personen untereinander.
IV. Fazit
Ein Auskunftsanspruch des Patienten gegen den Arzt stützt sich zwar nunmehr vorrangig auf § 630g Abs.2 BGB. Dieser kann sowohl in handschriftlicher als auch in elektronischer Form erfolgen. Allerdings besteht nach einheitlicher Ansicht der Gerichte kein Anspruch auf Erteilung lesbarer Behandlungsunterlagen. Der Patient wird hinreichend durch die Möglichkeit jederzeitiger Fachberatung geschützt. Ein solcher Anspruch kann erst dann geltend gemacht werden, wenn die Abschriften in äußerst unverständlicher und für die Ärzte nicht nachvollziehbarer Weise verfasst werden.
[1] MüKoBGB/Wagner BGB § 630g Rn. 1-3
[2] MüKoBGB/Wagner BGB § 630g Rn. 14
Erstellt am 17.03.2022
So erreichen Sie unsere Kanzlei in Köln:
Rechtsanwalt Dr. Martin Riemer
Fachanwalt für Medizinrecht und Versicherungsrecht