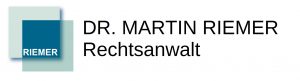Vorsicht Verfassungsbeschwerde
Einleitung
„Der Staat hat mich in meinen Grundrechten verletzt! Dagegen erhebe ich Verfassungsbeschwerde!“
Die Verfassungsbeschwerde ist wohl der bekannteste Rechtsbehelf, den viele Bürger bei jeglichen Rechtsstreitigkeiten sofort erheben wollen, aber nicht bedenken, dass dafür eine Vielzahl an Voraussetzungen gegeben sein muss, damit diese zur Entscheidung angenommen wird und darüber hinaus auch zulässig und begründet ist.
Als außerordentlicher Rechtsbehelf soll sie gleich mehrere Funktionen erfüllen. Zum einen soll es dadurch den Bürgern gem. Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG ermöglicht werden Eingriff in ihre Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte durch die deutsche Staatsgewalt abzuwehren. Jedoch erschöpft sich deren Sinngehalt nicht allein im individuellen Grundrechteschutz, sondern soll andererseits auch das objektive Verfassungsrecht wahren, dessen Auslegung und Fortentwicklung dienen und eine Selbstkontrolle des staatlichen Handelns ermöglichen. Indem die Verfassungsbeschwerde jährlich circa 96 % aller Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ausmacht, ist sie für die Tätigkeit des Gerichts von unvergleichbarer hoher Relevanz.
Nichts desto trotz lassen sich hinter dieser scheinbar makellosen Fassade des Bundesverfassungsgerichts immer wieder Probleme in Bezug auf Verfassungsbeschwerden erkennen.
Subsidiaritätsprobleme
Eine der Zulässigkeitsvoraussetzungen von Verfassungsbeschwerden ist, dass der Grundsatz der Subsidiarität gewahrt sein muss, der durch das Bundesverfassungsgericht im Wege der richterlichen Rechtsfortbildung entwickelt wurden ist und über das Gebot der Rechtswegerschöpfung im engeren Sinne hinausgeht. Dadurch wird der Beschwerdeführer verpflichtet, vor der Erhebung der Verfassungsbeschwerde sämtliche ihm zur Verfügung stehende Rechtsbehelfe auszuschöpfen, um die behauptete Grundrechtsverletzung zu beseitigen. Ziel ist es, dass dadurch das Bundesverfassungsgericht entlastet wird, indem die Funktionenteilung zwischen der Fach- und Verfassungsgerichtsbarkeit weiterhin sichergestellt bleibt und daraus resultierend die Funktionsfähigkeit des Bundesverfassungsgerichts gewahrt wird, sowie die Rechtslage durch die jeweils zuständigen Fachgerichte hinreichend aufgeklärt wird, damit das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung auf gesicherter Tatsachengrundlage treffen kann.
Dieser Grundsatz hat über Jahre hinweg viele Beschwerdeführer vor Probleme gestellt. Allerdings haben sich mittlerweile einige Standardproblemfälle herauskristallisiert, die der Zulässigkeit im Weg stehen können. So verpflichtet der Subsidiaritätsgrundsatz den Beschwerdeführer dazu, dass wenn sich die Verfassungsbeschwerde nicht auf eine Verletzung des rechtlichen Gehörs stützt, dennoch eine Anhörungsrüge ergriffen werden muss, wenn ein Gehörverstoß durch ein Fachgericht naheliegt und zu erwarten wäre, dass besonnene Verfahrensbeteiligte einen solchen Rechtsbehelf ergreifen würden. Außerdem muss bei einem einstweiligen Rechtsschutz vorerst das Hauptsacheverfahren abgewartet werden, worauf sich der Beschwerdeführer im Rahmen der Rechtswegerschöpfung nicht verweisen lassen muss, jedoch bei der Wahrung der Subsidiarität, wenn durch das Hauptsacheverfahren die Möglichkeit besteht, dass der Beschwer abgeholfen werden kann. Darüber hinaus stehen einem Beschwerdeführer gegen formelle Gesetze keinerlei Rechtswege offen, jedoch muss er grundsätzlich den Vollzug der Norm abwarten, um dann gegen den Einzelakt vorzugehen, sodass das Fachgericht daraufhin eine konkrete Normenkontrolle gem. Art. 100 Abs. 1 GG anstrengen könnte. Des Weiteren ist er verpflichtet bei Gesetzen, die Ausnahmen zulassen, zunächst eine solche Regelung zu beantragen, bevor er bei einem Versagen der Gestattung der Ausnahmeregelung gegen die Norm vorgeht.
Jedoch besteht diese Verpflichtung der Beachtung des Subsidiaritätsgrundsatzes nicht, wenn die Wahrung der Subsidiarität unzumutbar wäre oder die Voraussetzungen des § 90 Abs. 2 S. 2 BVerfGG vorliegen, die sich zwar auf die Rechtswegerschöpfung beziehen, jedoch auch bei der Subsidiarität sinngemäß angewandt werden können. Demnach kann von dem Subsidiaritätsgrundsatz abgesehen werden, wenn die Sache allgemeine Bedeutung hat, also durch sie verfassungsrechtliche Fragen aufgeworfen werden und eine Entscheidung darüber Klarheit für eine Vielzahl ähnlicher Fälle schaffen würde oder dem Beschwerdeführer bei der Ausschöpfung der Rechtsbehelfe ein schwerer und unabwendbarer Nachteil entstünde. Ein solcher charakterisiert sich dadurch, dass der Nachteil mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten wird und trotz späterem Erfolg der Beschwerde sich nicht hinreichend ausgleichen lasse. Von einer Unzumutbarkeit wird ausgegangen, wenn der Beschwerdeführer zu schwerwiegenden Dispositionen gezwungen werden würde, die später nicht mehr oder nur schwer korrigiert werden könnten, er gegen eine straf- oder bußgeldbewehrte Norm verstoßen müsste, um im anschließenden Verfahren die Verfassungswidrigkeit der Norm zu rügen oder aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung oder eindeutiger gesetzlicher Normierungen keine andere Beurteilung der Sachlage zu erwarten ist. Ferner kann die Unzumutbarkeit auch darin bestehen, dass der Beschwerdeführer fehlerhaft über das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen eines Rechtsweges unterrichtet wurden ist oder ihm die Prozesskostenhilfe abschließend verwehrt wird. Ein Hauptsacheverfahren muss nicht abgewartet werden, wenn eine Klage aufgrund entgegenstehender fachgerichtlicher Rechtsprechung offensichtlich sinn- und aussichtslos wäre, die Vorrausetzungen des § 90 Abs. 2 S. 2 BVerfGG vorliegen und die Entscheidung keiner weiteren Aufklärung bedarf oder eine Grundrechtsverletzung durch die Eilentscheidung selbst gerügt wird, wie beispielsweise eine Verletzung von Art. 19 Abs. 4 GG oder Art. 103 Abs. 1 GG.
Das Problem der Monatsfrist bei Urteilsverfassungsbeschwerden
Ein weiteres Problem im Rahmen der Zulässigkeit stellt die Monatsfrist des § 93 Abs. 1 BVerfGG bei Urteilsverfassungsbeschwerden dar. Diese berechnet sich nach den allgemeinen Prozessrechtsregeln gem. §§ 222 ZPO, 187 ff. BGB und beginnt mit der Zustellung, Verkündung oder Bekanntgabe des letztinstanzlichen Urteils.
Jedoch bereitet diese Frist den Beschwerdeführern oftmals schlaflose Nächte. Es scheint eine nahezu unmögliche Angelegenheit zu sein, innerhalb eines Monats eine Verfassungsbeschwerde einzulegen, die jegliche Voraussetzungen wahrt. So müssen Annahme- und Zulässigkeitsvoraussetzungen gegeben sein und die Beschwerde muss zudem hinreichend begründet werden. Diese seitenlangen Ausführungen niederzuschreiben bedarf eines immensen fachlichen Wissens und erheblichen Zeitaufwandes. Daher stellt sich die Frage, wieso diese kurze Frist nicht verlängert und beispielsweise auf zwei Monate angehoben wird.
Dagegen dürfte sprechen, dass dadurch weniger Verfassungsbeschwerden an der „Frist-Hürde“ scheitern würden und mithin müsste sich das Bundesverfassungsgericht mit weitaus mehr Beschwerden auseinandersetzen. Da die beiden Senate mit je acht Richtern und deren Richterdezernate bestehend aus mindestens vier wissenschaftlichen Mitarbeitern, die meist Richter der Fachgerichte, Staatsanwälte oder Regierungs- und Verwaltungsbeamte und manchmal auch Rechtsanwälte oder Hochschulmitarbeiter sind (vgl. Maunz/ Schmidt-Bleibtreu/ Klein/ Bethge/ Hömig, 60. EL Juli 2020, BVerfGG § 2 Rn. 10), ohnehin schon drohen unter der Last der eingehenden Beschwerden zusammenzubrechen, würden sie dann diese Anzahl wohl kaum bewältigen können. Demgemäß müssten mehr Richter und folglich weitere Dezernatsmitarbeiter eingestellt werden, was jedoch erhebliche Kosten verursachen würde. Denn Richter des Bundesverfassungsgerichts erhalten eine Vergütung in Höhe von der Besoldung des Präsidenten eines obersten Bundegerichtshofs, sprich Besoldungsgruppe R 10, sowie eine Amtszulage in Höhe von 12,5 % des Grundgehalts. Diese Kosten dürften insofern der wohl entscheidende Grund sein, wieso man von einer Fristverlängerung für Urteilsverfassungsbeschwerden bisher abgesehen hat. Überdies spricht dagegen, dass so eine weitaus größere Zahl unterschiedlicher Meinungen in den Senaten vertreten wäre, wodurch eine Entscheidungsfindung wesentlich erschwert werden würde und sich richterliche Beratungen und Diskussionen zeitlich ausdehnen würden und es dadurch länger dauern würde, bis eine Beschwerde entschieden wird. Zudem muss auch bedacht werden, dass das Bundesverfassungsgericht keine Superrevisionsinstanz sein soll, es aber andererseits ein Gericht für die Bürger ist, welches „Jedermann“, der behaupten kann in einem seiner Grundrechte oder grundrechtsgleichen Rechte verletzt zu sein, ermöglichen soll seine Beschwer vor dem Bundesverfassungsgericht geltend zu machen. Hingegen wird dies aber vielen Menschen verwehrt nur, weil sie das Fristerfordernis nicht gewahrt haben, aber die Beschwerde – angenommen sie hätten die Monatsfrist eingehalten – Erfolg hätte. Dies dürfte jedoch bei etlichen Beschwerdeführern auf Unverständnis stoßen, da lediglich ein paar Tage oder Stunden über den Erfolg der Beschwerde entscheiden können und dies dem eigentlichen Zweck der Verfassungsbeschwerde, staatliche Eingriffe in die Grundrechte oder grundrechtsgleichen Rechte abzuwehren, zuwiderläuft und insofern diese hohe Zulässigkeitsvoraussetzung den Bürger als Schikane erscheint. Nur in dem Fall, dass der Beschwerdeführer unverschuldet die Frist versäumt hat, kann gem. § 93 Abs. 2 S. 1 BVerfGG auf Antrag eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand gewährt werden, ansonsten ist die Wahrung der Monatsfrist eine zwingende Zulässigkeitsvoraussetzung der Urteilsverfassungsbeschwerden.
Sollte man es trotz der geringen Zeit geschafft haben eine Verfassungsbeschwerde zu verfassen, ist davon abzuraten diese kurzfristig per Telefax einzureichen. Denn wenn die Vielzahl an Dokumenten innerhalb der Frist eingehen muss, aber gleichzeitig auch andere Beschwerdeführer aufgrund der kurzen Frist erst am letzten Tag die Beschwerde fertig verfasst haben und noch übermitteln müssen, ist das Telefaxempfangsgerät des Bundesverfassungsgerichts oftmals spät abends belegt. Dementsprechend kann die rechtzeitig vollständig verfasste Verfassungsbeschwerde dennoch verfristet eingehen und wäre dann aus diesem Grund unzulässig. In solchen Fällen, in denen der Beschwerdeführer nicht früh genug mit der Übermittlung begonnen hat, sodass er sich unter üblichen Umständen nicht auf einen fristgerechten Eingang einstellen konnte, kann er auch nicht auf eine Wiedereinsetzung hoffen, da es sich hierbei um ein bekanntes Ereignis handelt mit welchem man rechnen müsse.
Viele Klagen, geringe Erfolgsquote, keine Begründung und hohes Risiko – eine scheinbar nicht enden wollende Tradition des Bundesverfassungsgerichts
Man könnte es schon fast als Brauchtum bezeichnen: Seit Jahrzenten gehen unzählige Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht ein, welches aber vergleichsweise sparsam mit Urteilen zugunsten der Beschwerdeführer umgeht.
Die meisten Beschwerden werden erst gar nicht angenommen. Von diesen Nichtannahmebeschlüssen werden lediglich circa 4,5 % mit einer Begründung versehen. Weitere 10-16 % enthalten nur einen kurzen Hinweis zur Unzulässigkeit oder Unbegründetheit und völlig unkommentiert bleiben meist 80 % der Verfassungsbeschwerden. Demnach ist vielen Beschwerdeführern nicht einmal klar, aus welchen Gründen genau ihre Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen wurden ist und lässt deren immensen Aufwand dieses Verfahren anzustrengen verblassen. Aber leider ist es mittlerweile üblich, dass ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht mit einem weißen Papier beendet wird, was jedoch oftmals auf Kritik gestoßen ist. So bestehen keine Kriterien wann eine Begründung (nicht) verfasst wird, das Bundesverfassungsgericht muss zudem nicht den maßgeblichen rechtlichen Gesichtspunkt nennen und es scheint so als wolle man aus Effektivitätsgründen zugunsten des Senats lieber die Kammer sich damit befassen lassen. Außerdem wird ohnehin ein Gutachten (Votum) am Gericht verfasst, sodass nicht ersichtlich ist, wieso man nicht die entscheidenden Gründe redaktionell zusammenfasst und dem Beschwerdeführer zukommen lässt. Darüber hinaus kann nicht einmal der EGMR bei den unbegründeten Nichtannahmebeschlüssen erkennen, ob und in welchem Umfang sich das Bundesverfassungsgericht wirklich mit den einschlägigen Grundrechten befasst hat, die oftmals auch durch die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) garantiert werden. Dem wird jedoch entgegengehalten, dass durch einen Begründungszwang nur das Bundesverfassungsgericht mehr Arbeit hätte, aber der Beschwerdeführer dadurch letztendlich nicht bessergestellt ist und mithin keinerlei Gewinn hätte.
Beachtlich ist jedoch, dass die Anzahl der entschiedenen und mitentschiedenen Verfassungsbeschwerden seit Jahren ansteigt. So wurden bereits 1987 2.638 Beschwerden entschieden bzw. mitentschieden, wohingegen es 2020 insgesamt 5.361 Beschwerden gewesen sind, mit zwischenzeitlichem Höchststand von 6.292 Beschwerden im Jahr 2014. Allerdings sind sie alle durch eine Gemeinsamkeit miteinander verbunden: Nur ungefähr 2 % sind letztendlich erfolgreich. Beispielsweise hatten 2020 gerademal 111 der entschiedenen und mitentschiedenen Beschwerden Erfolg, was einer Erfolgsquote von lediglich 2,07 % entspricht. Aber auch in den Jahren ab 1987 betrug diese nur zwischen 0,97 % (1997) und 5,55 % (1992), mit Ausnahme der Jahre 1990 (17,09 %) und 1991 (7,13 %), sodass sie sich um einen Mittelwert zwischen 1,5-3,0 % einpendelt. Dies liegt mitunter an dem eng gefassten Prüfungsmaßstab, aber auch an der Unwissenheit der Beschwerdeführer und deren Bevollmächtigten bezüglich der Besonderheiten des Verfassungsprozessrechts.
Welche Kosten kommen bei Erhebung einer Verfassungsbeschwerde auf den Beschwerdeführer zu?
Zu beachten ist, dass das Verfahren gem. § 34 Abs. 1 BVerfGG, im Gegensatz zu vielen anderen Gerichtsverfahren, grundsätzlich gerichtskostenfrei ist, auch wenn die Beschwerde erfolgslos geblieben ist. Jedoch gilt dies nicht bei offenkundig aussichtslosen oder bewusst schikanös erhobenen Beschwerden, sodass bei diesen eine Missbrauchsgebühr von bis zu 2.600 € erhoben werden kann (§ 34 Abs. 2 BVerfGG). Außerdem können Anwaltskosten, auch im Falle einer erfolgreichen Beschwerde, meist nur teilweise nach Pauschalsätzen erstattet werden. Nur die wenigsten Rechtsschutzversicherungen zahlen für die Erhebung einer Verfassungsbeschwerde. Dies ist zwar von den jeweiligen Vertragsbedingungen abhängig, aber meist sind Verfassungsbeschwerden aus den Verträgen ausgeschlossen und nur selten übernimmt die Versicherung die Kosten aus Kulanz. Sollte dies dennoch der Fall sein, dann werden jedoch nur die gesetzlichen Gebühren gemäß des RVG, die sich nach dem Gegenstandswert des Verfassungsbeschwerdeverfahrens bestimmen, übernommen und nicht die deutlich höheren vereinbarten Honorare. Mithin beträgt die schlichte Erstberatungsgebühr nur 190 €, wenn der Auftraggeber Verbraucher ist und keine Vereinbarung bezüglich der Gebühren getroffen wurden ist. Sollte daraufhin der Anwalt den Auftrag erhalten und die Erfolgsaussichten der Beschwerde prüfen und diese zudem auch erheben, dann entstehen allerdings weitaus höhere Kosten. Für die Prüfung der Erfolgsaussicht kann dieser analog gem. VV 2100 i.V.m. § 13 RVG eine Gebühr nach dem Faktor 0,5-1,0 verlangen, wenn darüber hinaus auch die Ausarbeitung eines Gutachtens umfasst ist, erhöht sich dieser auf die 1,3-fache Steigerung. Wird eine Verfassungsbeschwerde letztendlich auch eingelegt, erhält der Anwalt eine Verfahrensgebühr nach dem Faktor 1,6 gem. Nr. 3206 VV RVG. Hinzukommen können außerdem Verkehrsanwaltsgebühren (VV 3400) oder Termingebühren in Verhandlungs-, Erörterungs- oder Beweisaufnahmeterminen (VV 3210).
Daher stellt eine Verfassungsbeschwerde für viele Beschwerdeführer ein hohes Risiko dar, da die Erfolgsaussichten verschwindend gering sind, die Kosten aber umso zuverlässiger entstehen werden.
Lang, lang ist´s her – die Problematik der überlangen Verfahrensdauer
Die Überbelastung des Bundesverfassungsgerichts äußert sich unter anderem in der meist sehr langen Verfahrensdauer. Gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK sind die Gerichte dazu verpflichtet die Verfahren fair und innerhalb einer angemessenen Frist zu verhandeln. Auch durch das Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 GG i.V.m. dem verfassungsrechtlich garantierten Rechtsschutz des Art. 19 Abs. 4 GG sind die Gerichte und somit auch das Bundesverfassungsgericht dazu angehalten, weswegen zeitintensive Verfahren folglich nicht gänzlich unproblematisch sind. So wurde das Bundesverfassungsgericht schon mehrfach durch den EGMR gerügt, da dieser Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK verletzt sah.
Doch was ist eine angemessene Verfahrensdauer? Problematisch ist, dass sich dem Grundgesetz keine Zeitvorgaben entnehmen lassen, wann ein Verfahren zu lange andauert und resultierend daraus ein effektiver Rechtsschutz nicht gewährleistet ist. Lediglich § 97 b Abs. 1 S. 4 BVerfGG lässt erkennen, dass eine Verfahrenszeit von einem Jahr noch als angemessen gilt, da eine Verzögerungsrüge nicht eher als ein Jahr nach Eingang des Verfahrens beim Bundesverfassungsgericht erhoben werden kann. Demzufolge ist dies eine Frage der Abwägung, bei der die Natur des Verfahrens, das Gewicht der Beschwerde und deren soziale und politische Bedeutung, sowie das öffentliche Interesse daran, die Folgeauswirkungen der Verfahrenslänge für die Akteure, Komplexität und Herausforderungen der Sachmaterie und nicht durch das Gericht beeinflussbare Tätigkeiten Dritter – wie Handlungen der Sachverständigen – wichtige Anhaltspunkte bilden. Ob eine zeitnähere Erledigung eines Verfahrens möglich gewesen wäre, ist allerdings nicht von Bedeutung für die Beurteilung der Angemessenheit der Verfahrensdauer.
Wie lange ein Verfahren letztendlich jedoch dauert, lässt sich nicht vorhersagen, da dies von verschiedenen Gesichtspunkten abhängt. Entscheidend können dabei die Bedeutung und Dringlichkeit der Beschwerde sein, die (Über-)Belastung des Bundesverfassungsgerichts, aber auch die Belastbarkeit und das fachliche Können der einzelnen Richter und deren Engagement an der verfassungsgerichtlichen Arbeit. Laut Statistik des Bundesverfassungsgerichts betrug die durchschnittliche Verfahrensdauer von Verfassungsbeschwerden zwischen 2008 bis 2015 in 64,2 % der Beschwerden lediglich ein Jahr und weitere 21,8 % zwei Jahre, wohingegen 5,2 % der Beschwerden ganze drei Jahren in Anspruch nahmen und sogar 1,8 % mehr als 4 Jahre; 7 % sind anhängig geblieben. Der Grund, warum Verfahren anhängig bleiben, ist meist senatsintern begründet, denn wenn beispielsweise Berichterstatter Probleme bei einer Mehrheitsfindung des Senats sehen, dann kann es sein, dass das Verfahren einfach nicht weiter vorangetrieben wird. So kam es schon dazu, dass 1994 eine Verfassungsbeschwerde erhoben wurden ist, das Bundesverfassungsgericht jedoch untätig blieb und erst 2005 ein Urteil sprach.
Ideal wäre daher eine Verfahrensbeschleunigung. Doch diese ist stark begrenzt: Aufgrund dessen, dass die Funktion und Struktur des Bundesverfassungsgerichts durch das Grundgesetz und das BVerfGG gesetzlich niedergeschrieben sind, ist eine Kapazitätsausweitung ohne gesetzgeberisches Tätigwerden nicht möglich. Zudem ist stets eine umfangreiche Prüfung des Sachverhalts erforderlich.
Infolgedessen sind weiterhin mehrjährige, teils bis zu zehn Jahre andauernde, Verfahren keine Seltenheit, sodass der ein oder andere Beschwerdeführer zu befürchten hat, dass der Beschluss nicht mehr zu seinen Lebzeiten ergehen wird.
Diskussionen über die Auswahl der Richter des Bundesverfassungsgerichts
Gemäß Art. 94 Abs. 1 S. 2 GG i.V.m. §§ 5 ff. BVerfGG werden die insgesamt 16 Richter des Bundesverfassungsgerichts je zur Hälfte vom Bundesrat und vom Bundestag gewählt. Letzterer wählt auf Vorschlag eines Wahlausschusses, in welchem die Fraktionen entsprechend ihrer parlamentarischen Macht repräsentiert sind, wobei eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen und mindestens die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Bundestages erforderlich ist (§ 6 Abs. 1 BVerfGG). Beim Bundesrat ist hingegen nur eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen Voraussetzung (§ 7 BVerfGG). Durch dieses Wahlverfahren erhalten die Richter des Bundesverfassungsgerichts eine einzigartige demokratische Legitimität gegenüber den Bundesrichtern, da diese gem. Art. 95 Abs. 2 GG durch den zuständigen Bundesminister gemeinsam mit einem Richterwahlausschuss gewählt werden.
Umstritten ist jedoch, ob überhaupt eine Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Richter durch ein solches Wahlverfahren bestehen kann.
Befürworter bringen vor, dass dem hinreichend dadurch Rechnung getragen wird, dass gem. Art. 94 Abs. 1 S. 3 GG i.V.m. § 3 Abs. 3 BVerfGG die Richter nicht dem Bundestag, dem Bundesrat, der Bundesregierung oder anderen entsprechenden Organen eines Landes angehören dürfen. Außerdem solle durch die erforderliche Zweidrittelmehrheit der beiden Wahlorgane verhindert werden, dass die jeweilige politische Mehrheit einen Zugriff auf die Richterstellen erhält und dadurch eine ausgewogene Besetzung der Stellen gesichert sei. Des Weiteren zeige die Praxis, dass Richter, die zuvor Politiker gewesen sind, nichts desto trotz frei entscheiden und sich kein direkter Bezug zu deren politischen Positionen herstellen lasse. Und selbst wenn ein Interessenskonflikt eines Richters bestehen sollte, dann ist hierfür der Weg, das Verfahren ohne diesen Richter durchzuführen, eröffnet. Diese Möglichkeit wurde in der Praxis auch schon genutzt, wie beispielsweise bei der Entscheidung von 2018 über das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe (§ 217 StGB). Das Verfahren wurde ohne den Richter Peter Müller verhandelt, da dieser zuvor einen Gesetzesentwurf in den Bundestag eingebracht hatte, der deutliche inhaltliche Parallelen zu § 217 StGB aufwies, weswegen eine Befangenheit nicht völlig auszuschließen war. Ferner sei ein solches Wahlverfahren von Nöten, um die Funktionsfähigkeit des Bundesverfassungsgerichts gewährleisten zu können. Eine Übertragung der Richterwahl auf den Ausschuss sei zudem verfassungsrechtlich zulässig, da Art. 94 Abs. 1 S. 2 GG lediglich einen Gestaltungsauftrag für den Gesetzgeber enthält und eine Wahl durch den Ausschuss nicht ausgeschlossen ist, indem kein Wahlmodus durch die Verfassung vorgegeben wird. Auch werde dadurch nicht gegen die Repräsentationsfunktion des Bundestages verstoßen, welche er prinzipiell als eine Einheit – als Ganzes – ausübt. Schließlich benötigt das Bundesverfassungsgericht für eine Akzeptanz seiner Entscheidungen eine Einbeziehung der fundamentalen Parteien in den Wahlprozess und darüber hinaus habe sich dieses Wahlverfahren in der Praxis bewährt, indem es bisher stets zu einer ausgeglichenen Besetzung der Richterstellen geführt hatte.
Allerdings haben sich im Laufe der Zeit immer mehr Kritiker zu Wort gemeldet, das Wahlverfahren zunehmend unter Beschuss genommen und forderten unter anderem eine öffentliche Richterwahl durch das Bundestagsplenum oder zumindest eine öffentliche Anhörung im Ausschuss. Einer der Hauptkritikpunkte stellt die Intransparenz in den beiden Wahlorganen dar. Infolgedessen, dass die Hälfte der Richter durch den vertraulich tagenden Ausschuss ernannt wird, der jedoch nicht im Grundgesetz gesetzlich normiert ist, fehle es an Transparenz. Außerdem ist die wechselseitige Benennung der Richter nach Absprache zwischen den großen politischen Parteien bedenklich. Diese Vereinbarung rührt daher, dass eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. Dies gipfelt derzeit darin, dass die Richterstellen quasi unter den mächtigsten Parteien aufgeteilt werden, indem sie sich rotationsmäßig ein Vorschlagsrecht zugestehen. Kleine Parteien werden hingegen nur miteinbezogen, wenn die großen Parteien das Vorschlagsrecht abtreten, was vergleichsweise selten der Fall ist und auch nur dann erfolgt, wenn diese Partei ihr jeweiliger Koalitionspartner ist. Sobald ein Richter ausscheidet, steht der Partei, die den Richter vorgeschlagen hatte, erneut das Vorschlagsrecht zu, denn fiele dies dem Bundesjustizminister zu, würden die Rechte des Parlaments beschnitten werden. Das derzeitige Wahlverfahren führt allerdings dazu, dass meist parteinahe Kandidaten mit entsprechender politischer Position vorgeschlagen werden, sodass fachliche Qualifikationen nachrangig erscheinen. Grund dafür ist, dass das Bundesverfassungsgericht Gesetze für verfassungswidrig erklären und dadurch zwingend einzuhaltende politische Richtlinien vorgeben kann. Das Ergebnis ist, dass die Gerichtsbesetzung vielmehr die etablierten Parteien wiederspiegelt. Diese Kritik manifestiert sich insbesondere dann, wenn ehemalige Politiker als Richter des Bundesverfassungsgerichts gewählt werden und direkt nach ihrer Wahl vom Bundestag zum Bundesverfassungsgericht wechseln. Problematisch ist dies besonders dann, wenn Richter über die Verfassungskonformität von Gesetzen urteilen müssen, die ihre ehemaligen Kollegen verfasst haben, wodurch in der Bevölkerung das Vertrauen in die Unabhängigkeit des Gerichts geschmälert wird. Schließlich solle es kein Organ der Politik sein, dass die Politiker oder die politischen Tendenzen in der Bevölkerung repräsentiert. Aufgabe des Gerichts ist es vielmehr, unabhängig und unparteiisch zu urteilen.
Fazit: Das Bundesverfassungsgericht als „Schaufenstergericht“
Der Weg bis zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe ist kein leichter und häufig auch kein erfolgreicher. Die strengen Zulässigkeitsanforderungen an Verfassungsbeschwerden machen es entgegen dem Wortlaut des Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG im Ergebnis doch nicht für „jedermann“ möglich, eine Beschwerde zu erheben. Wer diese Hürde gleichwohl nimmt, bekommt als Beschwerdeführer zumeist einen Dämpfer verpasst, wenn diese bereits nicht zur Entscheidung angenommen wird. Doch nicht nur dieses Hindernis auf dem Pfad zu höchster Gerechtigkeit, sondern auch die lange Verfahrensdauer, sowie die Auswahl der Richter stellen weitere Kritikpunkte im Rahmen von Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgerichts dar, weswegen an zentralen Stellen des Verfahrens weiterhin nicht bloß die Feinjustierung zu kritisieren ist.
Erstellt am 26.03.2021
So erreichen Sie unsere Kanzlei in Köln:
Rechtsanwalt Dr. Martin Riemer
Fachanwalt für Medizinrecht und Versicherungsrecht

Louisa Poltersdorf
Studentische Mitarbeiterin