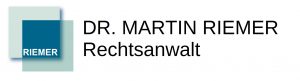Muss die Rechtsschutzversicherung für die Kosten eines Privatgutachtens aufkommen?
Mandanten irren zuweilen in der Vorstellung, eine Rechtsschutzversicherung wäre ein „Vollkaskoschutz“, der sie vor sämtlichen Rechtsverfolgungskosten bewahren würde. So einfach liegen die Dinge jedoch nicht: Eine Rechtsschutzversicherung ist ihrer Natur nach eine Schadensversicherung, die gem. § 125 VVG verpflichtet ist, die für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers (oder des Versicherten) erforderliche Leistungen im vereinbarten Umfang zu erbringen.
Wofür gewähren Rechtsschutzversicherungen Deckungsschutz?
Was zwischen dem Versicherer (VR) und dem Versicherungsnehmer (VN) als Deckungsschutz vereinbart ist, ergibt sich aus dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen. Im Versicherungsschein (auch Police genannt) ist geregelt, in welchem Tarif der Versicherungsnehmer versichert ist, und in den Allgemeinen Rechtsschutzversicherungs-Bedingungen (kurz: ARB) wird dieser tarifliche Schutz dann im Einzelnen näher ausgestaltet.
§ 2 ARB zählt zumeist die Leistungsarten auf, die unter den Versicherungsschutz fallen, z. B. Schadensersatz-Rechtsschutz, Arbeits-Rechtsschutz, Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz, Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht etc.
§ 3 ARB hingegen zählt auf, in welchen Rechtsangelegenheiten Deckungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen nicht besteht, z. B. in ursächlichem Zusammenhang mit Kriegsereignissen, Kernkraftunfällen, Patentstreitigkeiten, kollektivem Arbeitsrecht etc.
Zwar hat der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft e.V. ARB-Musterbedingungen erstellt, an denen sich die meisten Versicherer orientieren. Seit dem Jahr 1994 besteht für Versicherungsgesellschaften jedoch die Möglichkeit, individuelle Konditionen für ihre Kunden anzubieten, weswegen Versicherungsbedingungen immer im Einzelfall zu prüfen sind. Denn wegen vieler noch fortbestehender Altverträge gibt es heute sehr viele verschiedene ARBs.
Wann übernehmen Rechtsschutzversicherungen Privatgutachterkosten?
Nicht selten, z. B. bei der Verfolgung von Schadensersatzansprüchen, hängen die Erfolgsaussichten des Mandats von der Klärung medizinischer, technischer oder naturwissenschaftlicher Fragen ab, mit deren Beantwortung sowohl der Mandant selber, wie auch sein Anwalt überfordert sind und zu deren Aufklärung das Gericht einen Sachverständigen beauftragen würde, z. B.
ob ein ärztlicher Behandlungsfehler vorliegt und welche Folgen daraus resultieren,
die Höhe der Reparaturkosten nach einem Verkehrsunfall,
die Kosten für die Beseitigung eines Wasserschadens an einem Gebäude,
ob eine Maschine fehlerfrei funktioniert,
der Wert einer Immobilie (z. B. bei der Auseinandersetzung einer Miteigentumsgemeinschaft),
die Bewertung eines Unternehmensschadens, etc.
Was liegt also näher, als hierzu außergerichtlich bereits ein Sachverständigengutachten einzuholen, um die eigene Rechtsposition zu untermauern und dem Anspruchsgegner gegenüber besser darstellen zu können? Sinnvoll ist dieser Schritt, einen Privatsachverständigen zu beauftragen, oftmals allemal. Aber kommt die Rechtsschutzversicherung dafür auf?
Deckungsschutz für die Kosten gerichtlicher Sachverständiger
Auch dabei kommt es wiederum auf die individuell vereinbarten Bedingungen an, die ein Rechtsanwalt zuvor prüfen sollte. Die ARB-Musterbedingungen sehen in § 5 Abs. 1 c) nämlich regelmäßig nur Deckungsschutz für die Kosten von solchen Sachverständigen vor, die „vom Gericht herangezogen“ werden: Gelangt der Rechtsstreit vor Gericht und beauftragt das Gericht einen Sachverständigen, sind diese Kosten somit vom Deckungsschutz umfasst.
Eine Ausnahme hiervon bildet § 5 Abs. 1 f) ARB, der zur Verteidigung in verkehrsstrafrechtlichen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren und zur Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Kauf- und Reparaturverträgen von Motofahrzeugen (zu Lande) und Anhängern ebenfalls die Übernahme von Sachverständigenkosten vorsieht.
In allen anderen Fällen, auch wenn die Einholung eines Privatgutachtens zur Anspruchsdurchsetzung höchst sinnvoll sein mag, ist Kostenschutz über die Rechtsschutzversicherung in aller Regel ausgeschlossen: Diese Kosten müssen die Mandanten privat bezahlen.
Vom Gericht herangezogene Sachverständige
Wann ist ein Sachverständiger i.S.v. § 5 Abs. 1 c) der Muster-ARB jedoch „vom Gericht herangezogen“? – Gilt dies nur dann, wenn das Gericht selber den Sachverständigen beauftragt hat, oder auch dann bereits, wenn das Gericht einen Privatsachverständigen, den eine Prozesspartei beauftragt und zur mündlichen Verhandlung mitgebracht hat, in der mündlichen Verhandlung hört und/oder sein schriftlich erstattetes Gutachten im Urteil verwertet?
Diese Frage war umstritten in einem Fall, den der Ombudsmann für Versicherungen e.V. (Berlin) in einem Einzelfall zu klären hatte:
Eine Lehranalysandin (Ausbildungskandidatin zur Psychotherapeutin) verklagte ihren vormaligen Lehranalytiker vor dem Landgericht Köln auf Schadensersatz. Trotz grober Fehler des Lehranalytikers, der später wegen einer psychotischen Erkrankung stationär psychiatrisch untergebracht wurde, ging der Prozess verloren, da der gerichtlich bestellte Sachverständige nicht erkennen konnte, dass die (Behandlungs-)Fehler des Lehranalytikers zu irgendeinem nachweisbaren Gesundheitsschaden bei seiner Analysandin geführt hatten.
Das Landgericht hatte jedoch einen Sachverständigen bestellt, der lediglich Psychiater und nicht auch Psychoanalytiker war, weswegen die Klägerin einen Privatgutachter beauftragte, der ärztlicher Psychoanalytiker war und dem Gericht die emotionalen Folgen und Gesundheitsgefahren einer fehlgelaufenen Psychoanalyse als Privatsachverständiger darlegen sollte.
Das Landgericht setzte sich mit den Ausführungen dieses Privatsachverständigen im Urteil auch auseinander, so wie mit einem zweiten Gerichtssachverständigengutachten, folgte jedoch dem „Erstgutachter“ (LG Köln, Urteil 19 O 85/10 vom 14.10.2013). Das Oberlandesgericht Köln wies die Berufung gem. § 522 ZPO zurück (OLG Köln, Beschluss I-12 U 55/13 vom 4.6.2014).
[Beides schwer verständlich, da ein „grober Behandlungsfehler“ feststand: Das Landgericht war jedoch – insoweit zutreffend – der Auffassung, da es sich bei der Lehranalyse nicht um eine Patientenbehandlung, sondern um eine Ausbildung handelte, und – eher zweifelhaft – dass die Beweisgrundsätze des Arzthaftungsrechts auf den vorliegenden Fall daher nicht anwendbar wären, was wohl auch damit zusammenhing, dass der Rechtsstreit aufgrund einer Lücke der Geschäftsverteilungspläne sowohl beim Landgericht, wie auch beim Oberlandesgericht, nicht der Fachkammer bzw. dem Fachsenat für Medizinschadensfälle zugewiesen war.]
Zwischen der Klägerin und ihrer Rechtsschutzversicherung ging es sodann um die Frage, wer für die Kosten des psychoanalytischen Privatsachverständigen aufzukommen hatte: Die Rechtsschutzversicherung – oder blieb die Versicherungsnehmerin auf diesen verauslagten Kosten sitzen?
Wie hat der Versicherungsombudsmann den Fall entschieden?
Im Streit mit Versicherungen besteht für Privatpersonen die Möglichkeit, zur Klärung von Ansprüchen gegen ein Versicherungsunternehmen den Ombudsmann für Versicherungen e.V. in Berlin anzurufen (www.versicherungsombudsmann.de), was die Versicherungsnehmerin in diesem Fall getan hat. Dem Versicherungsombudsmann sind dabei, ähnlich wie in einer Klageschrift, alle zur Begründung des Deckungsanspruchs notwendigen Tatsachen vorzutragen und Belege vorzulegen. Er fordert das Versicherungsunternehmen sodann zu einer Stellungnahme auf und kann bei Ansprüchen bis 10.000 € eine für die Versicherung bindende Entscheidung treffen oder eine Empfehlung für die Regulierung aussprechen. Dieses Verfahren ist für Verbraucher – anders als ein Gerichtsverfahren – kostenfrei.
Im vorliegenden Fall lautete die Entscheidung des Versicherungsombudsmanns (ausgehend von den ARB 75/93) – negativ – wie folgt:
„Soweit die Beschwerdeführerin das Privatgutachten privat beauftragt hat, handelt es sich nicht um erstattungsfähige Gerichtskosten. Kostenschuldner des Gutachters ist originär die Auftraggeberin, in diesem Fall also die Beschwerdeführerin. Ist ein Sachverständiger nicht vom Gericht herangezogen worden, sind dessen Kosten nicht vom Versicherer zu tragen (vergleiche AG Köln r+s 1992, 58; AG Würzburg, r+s 1995, 264; Böhme, ARB, 12. Auflage, § 2 Rn. 25; van Bühren/Plote, ARB, 2. Auflage, § 5 Rn. 65; Harbauer, Rechtsschutzversicherung, 8. Auflage, § 5 ARB 2000 Rn. 116; Prölss/Martin, VVG, 28. Auflage, § 5 ARB 2008/ll Rn. 28; Mathy, Rechtsschutz-Alphabet, 2. Auflage, S. 693; Obarowski in: Münchener Kommentar zum WG, Anh. zu § 125, Rn. 96; Rüffer/Halbach/Schimikowski, VVG, 2. Auflage, § 5 ARB 2010 Rn. 10).“
Privatgutachterkosten, auch im gerichtlichen Verfahren, sind demnach vom Deckungsanspruch gegen die Rechtsschutzversicherung regelmäßig nicht umfasst.
Hätte die Klägerin einen Kostenersatzanspruch gegen den Lehranalytiker gehabt?
Anders hätte der Fall ausgesehen, wenn die Klägerin den Rechtsstreit gegen ihren Analytiker gewonnen hätte. In diesem Fall hätte die sie ihre Kosten, die zur Rechtsverfolgung notwendig waren, nämlich gem. § 91 ZPO gegen den Gegner festsetzen lassen können, wozu nicht nur Rechtsanwaltskosten zählen, sondern auch alle weiteren notwendigen „Auslagen“. Wenn sich eine nicht-fachkundige Partei in einen Rechtsstreit begibt, wo ihr die Sachkunde der zu klärenden Fachfragen fehlt (was hier der Fall war; die Klägerin war keine Ärztin), gehen die Gerichte im Kostenfestsetzungsverfahren regelmäßig davon aus, dass die Zuziehung eines Privatsachverständigen jedenfalls dann notwendig war, wenn dieser das Verfahren spürbar beeinflusst hat, z. B. wenn sich das Gericht in der mündlichen Verhandlung und/oder im Urteil mit seinen Ausführungen auseinander gesetzt hat (vgl. mit weiteren Nachweisen Bauer in: Harbauer, Rechtsschutzversicherung, 8.Aufl. 2010, § 5 Rn. 116).
Wie kann man „vorgerichtliche Sachverständigenkosten“ gleichwohl über die Rechtsschutzversicherung decken?
„Vorgerichtliche“ Kosten an sich nicht. Zur Klärung von Sachverständigenfragen kann der Versicherungsnehmer jedoch gem. § 485 ZPO „während oder außerhalb eines Streitverfahrens“ ein sog. selbständiges Beweisverfahren (Beweissicherungsverfahren) beantragen. Dieses ist ein Gerichtsverfahren, nicht viel anders als eine Hauptsacheklage – und für diese Kosten muss die Rechtsschutzversicherung bedingungsgemäß wiederum eintreten.
Anders als bei der Beauftragung eines Privatgutachters bestellt im selbständigen Beweisverfahren nämlich wiederum das angerufene Gericht einen Sachverständigen und beauftragt ihn, die zu klärenden Beweisfragen, mit Bindungswirkung für das spätere Klageverfahren, zu beantworten. Dieser Weg wird z. B. eingeschlagen und von Anwälten empfohlen, wenn der „Verlust eines Beweismittels“ droht. Z. B. bei Zahnarzthaftung, wenn das fehlerhaft gearbeitete Gebiss in diesem Zustand nicht bleiben kann, bis ein Zahnarzthaftungsverfahren durch möglicherweise zwei Instanzen in ca. 3 Jahren abgeschlossen ist, sondern der Patient die Zahnarztfehler zuvor bereits beheben lassen muss.
Gegen die Kosten von Beweissicherungsverfahren können sich die Rechtsschutzversicherungen nicht sperren. Diese müssen sie akzeptieren.
Abweichende Regelung im Sozialrecht
Anders ist die Rechtslage jedoch im Sozialrecht. In § 109 Abs.1 SGG wird Versicherten, die mit einem gerichtlich eingeholten Gutachten nicht einverstanden sind, das Recht auf Anhörung eines – wenn man so möchte – ärztlichen Privatgutachters eingeräumt: „Auf Antrag des Versicherten, des behinderten Menschen, des Versorgungsberechtigten oder Hinterbliebenen muss ein bestimmter Arzt gutachtlich gehört werden. Die Anhörung kann davon abhängig gemacht werden, dass der Antragsteller die Kosten vorschießt und vorbehaltlich einer anderen Entscheidung des Gerichts endgültig trägt.“
Diese Gutachterkosten sind vom Deckungsanspruch gegen die Rechtsschutzversicherung wiederum umfasst, da auch hier wiederum das Gericht den vom Kläger benannten Arzt als Zweitgutachter bestellt und anhört.
Stand: 30.04.2017