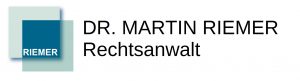Bundesgerichtshof hat über Datenauskunftsanspruch entschieden
Lange bereits erwartet, hat der VI. Senat des Bundesgerichtshofs in einer seitens der Kanzlei Dr. Riemer erstrittenen Grundsatzentscheidung (vor dem BGH vertreten durch den BGH-Anwalt Kofler) über die Reichweite des Datenauskunftsanspruchs gem. Art,. 15 DS-GVO entschieden (VI ZR 576/19, Urteil vom 15.6.2021).
Diese war in der Literatur und der unterinstanzlichen Rechtsprechung bislang äußerst umstritten, darf nun jedoch weitgehend als geklärt gelten.
Zusammengefasst:
1. Gem. Art. 4 Nr. 1 Halbsatz 1 DS-GVO sind „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Dieser Begriff ist weit zu verstehen. Er ist nicht auf sensible oder private Informationen beschränkt, sondern umfasst alle Arten von Informationen sowohl objektiver als auch subjektiver Natur in Form von Stellungnahmen oder Beurteilungen, unter der Voraussetzung, dass es sich um Informationen über die in Rede stehende Person handelt oder diese mit ihr verknüpft sind.
2. Gem. Erwägungsgrund 63 Satz 1 DS-GVO dient das Auskunftsrecht der betroffenen Person hinsichtlich der sie betreffenden personenbezogenen Daten dem Zweck, sich der Verarbeitung bewusst zu sein und deren Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Der Datenauskunftsanspruch aus Art. 15 DS-GVO erstreckt sich daher auch auf die zwischen einem Versicherungsnehmer und dem Versicherer gewechselte Korrespondenz, die Daten zum „Prämienkonto“ des Versicherungsvertrags, dem Gesundheitszustand des Versicherungsnehmers, den Versicherungsschein sowie versicherungsinterne Vermerke und Kommunikation aller Art.
3. Des Auskunftsanspruch nach Art. 15 DS-GVO ist durch das Verlangen nach einer „vollständigen Datenauskunft“ hinreichend präzisiert und beschränkt sich nicht auf Daten, die dem Betroffenen noch nicht bekannt sind. Auch die Kategorisierung als „interne Vermerke“ durch die datenverarbeitende Stelle steht dem Auskunftsrecht nicht entgegen.
4. Rechtliche Analysen können zwar personenbezogene Daten enthalten und unterfallen auch insoweit dem Auskunftsanspruch. Die auf ihrer Grundlage vorgenommene Beurteilung der Rechtslage selbst stellt jedoch ebenso wie Daten zu Provisionszahlungen einer Versicherungsgesellschaft an Dritte keine Information über den Betroffenen dar.
5. Erfüllt i.S.v. § 362 Abs. 1 BGB ist ein Auskunftsanspruch grundsätzlich dann, wenn die Angaben nach dem erklärten Willen des Schuldners die Auskunft im geschuldeten Gesamtumfang darstellen. Wird eine Auskunft in dieser Form erteilt, steht ihre etwaige inhaltliche Unrichtigkeit einer Erfüllung nicht entgegen. Der Verdacht, dass die erteilte Auskunft unvollständig oder unrichtig ist, kann einen Anspruch auf Auskunft in weitergehendem Umfang nicht begründen. Wesentlich für die Erfüllung des Auskunftsanspruchs ist daher die – gegebenenfalls konkludente – Erklärung des Auskunftsschuldners, dass die Auskunft vollständig ist.
6. Die Annahme eines derartigen Erklärungsinhalts setzt jedoch voraus, dass die erteilte Auskunft erkennbar den Gegenstand des berechtigten Auskunftsbegehrens vollständig abdeckt. Daran fehlt es beispielsweise dann, wenn sich der Auskunftspflichtige hinsichtlich einer bestimmten Kategorie von Auskunftsgegenständen nicht erklärt hat, etwa weil er irrigerweise davon ausgeht, er sei hinsichtlich dieser Gegenstände nicht zur Auskunft verpflichtet. In diesem Fall kann der Auskunftsberechtigte eine Ergänzung der Auskunft verlangen.
Die vom Landgericht Köln gegen das Urteil 26 S 13/18 vom 19.6.2019 zugelassene Revision war zunächst beim IV. Zivilsenat anhängig, wurde von dort jedoch an den VI. Senat abgegeben.
Stand: 04.07.2021
Bundesgerichtshof entscheidet am 15.6.2021 über Datenauskunftsanspruch gem. Art. 15 DSGVO
Das Bundesarbeitsgericht (Az. 2 AZR 342/20) hat am 27.4.2021 für die Arbeitsgerichtsbarkeit über den Datenauskunftsanspruch eines ausgeschiedenen Arbeitnehmers gem. Art. 15 Abs. 3 DS-GVO gegen seinen Arbeitgeber entschieden.
Nach mündlicher Verhandlung vom 20.4.2021 hat nun auch der Bundesgerichtshof (Az. IV ZR 576/19) für den 15.6.2021 ein Revisionsurteil über den Datenauskunftsanspruch eines Versicherungsnehmers gegen eine Lebensversicherung angekündigt.
In beiden Fällen geht es letztlich um das „Recht auf Kopie“ aus Art. 15 Abs. 3 DS-GVO. Anders als das Bundesarbeitsgericht, welches die Revision zurückwies, da es den Klageantrag des Arbeitnehmers bereits als nicht hinreichend bestimmt erachtete und sich damit um eine Entscheidung zur materiellen Reichweite des Datenauskunftsanspruchs „herumdrückte“, wird der Bundesgerichtshof in der Sache entscheiden, da es gegen die Bestimmtheit der Klageanträge laut vorläufiger Einschätzung in der Revisionsverhandlung keine Bedenken hatte.
Entscheidend – so der BGH – für die Beurteilung des Anspruchs aus Art. 15 Abs. 3 DS-GVO komme es auf die Defition des Begriffs der „personenbezogenen Daten“ in Art. 4 Nr. 1 DS-GVO an. Der Bundesgerichtshof ließ dazu durchblicken, dass er das Berufungsurteil des LG Köln, 26 S 13/18, vom 19.6.2019 aufheben wird, da das Landgericht diesen Rechtsbegriff falsch angewandt und den Auskunftsanspruch daher rechtsfehlerhaft verkürzt habe.
Für die Auslegung des Begriffs der „personenbezogenen Daten“ sei – so der BGH – auf den Wortlaut in Art. 4 Nr. 1 DS-GVO auszugehen. Der Verordnungsgeber der Datenschutz-Grundverordnung habe mit dieser Legaldefinition einen weit gefassten Schutzbereich für Betroffene eröffnen wollen, was sich auch auf den Auskunftsanspruch gem. Art. 15 Abs. 1 und 3 DS-GVO erstrecke.
Ebenso wie das BAG hat auch der BGH eine Anrufung des EuGH gem. Art. 267 Abs. 3 AEUV nicht für erforderlich angesehen, so sehr man sich auch eine richtungsweisende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu diesem in Rechtssprechung und Literatur viel diskutierten Punkt, wie weit der Datenauskunftsanspruch reicht, wünschen mag.
Die beiden Streitsachverhalte sind in unterschiedlichen Kontexten entstanden: Während das Bundesarbeitsgericht über eine Revision gegen das Urteil des Landesarbeitsgericht Niedersachsens, Az. 9 Sa 608/19, vom 9.6.2020 zu entscheiden hatte, im Verhältnis zu einem Arbeitgeber, geht es im Zivilprozess vor dem BGH im Ausgangsstreit um eine Versicherungsverhältnis.
Arbeitnehmer versuchen den Datenauskunfts-Anspruch nicht selten zu missbräuchlichen Zwecken zu verwenden. Zahlt der Arbeitgeber im Beendigungsfall die gewünschte Abfindung nicht, wird versucht, über einen ergänzenden Auskunftsanspruch im Kündigungsschutzprozess Druck auf ihn auszuüben: Entweder du zahlst, oder ich bereite dir mit dem Auskunftsverlangen einen immensen Suchaufwand, um diesen vollständig zu erfüllen. Dass diesem Vorgehen die Missbräuchlichkeit auf die Stirn tätowiert steht, liegt an sich auf der Hand, was das Bundesarbeitsgericht wohl jedoch so direkt nicht sagen wollte und einer inhaltlichen (materiell-rechtlichen) Klärung daher ausgewichen ist: Andernfalls wäre es nach den jüngsten Ermahnungen durch das Bundesverfassungsgericht (Az. 1 BvR 2853/19) im Beschluss vom 14.1.2021 um eine Vorlage an den EuGH kaum herumgekommen.
Anders hingegen verhält es sich mit dem Datenauskunftsanspruch im Verhältnis gegenüber Versicherungen. Dort sind die „personenbezogenen Daten“ der Versicherungsnehmer und versicherten Personen in Vertrags- und Leistungsakten komprimiert zusammengasst. Die Versicherungen führen heute nahezu ausschließlich nur noch E-Akten. Sie brauchen somit in ihren elektronischen Dokumentenmanagementsystemen nur zu schauen, welche Daten sie zu diesen Aktennummern gespeichert haben, diese auf CD-Rom zu kopieren (Kosten: ca. 1 €) und der betroffenen Person zu übersenden. Ein „unverhältnismäßiger Arbeitsaufwand“ verbindet sich damit nicht.
Soweit Versicherungsgesellschaften dagegen einwenden, dieses Vorgehen bedeute, dass sie „ausgeforscht“ würden, wird dieser gerne ins Feld geführte pauschale Einwand nicht durchdringen. Zwar ist es richtig, dass nach der Systematik der Datenschutz-Grundverordnung die Rechte aus Art. 15 Abs. 3 DS-GVO vorrangig den weiteren Rechten aus Art. 16 (Berichtigung), Art. 17 (Löschung) und Art. 18 (Einschränkung der Verarbeitung) dienen sollen. Aber eben nicht ausschließlich, wie der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln bereits wiederholt entschieden hat, vgl. OLG Köln, Beschluss 20 W 10/18, vom 3.9.2019 und 20 W 9/19 vom 6.2.2020: Dort wurde jeweils im Rahmen der Streitwertfestsetzung auf pauschal 5.000 € zugrunde gelegt, dass das Datenauskunftsanspruch auch „wirtschaftlichen Interessen“ dienen darf, sprich: Anderen als jenen der Art. 16 – 18 Ds-GVO.
Der 9. Zivilsenat hat sich dem im Beschluss OLG Köln, 9 W 34/20, vom 12.11.2020 grundsätzlich angeschlossen und damit seine frühere Rechtsprechung aus dem Urteil OLG Köln 9 U 120/17 vom 5.2.2018, noch aus der Zeit vor Inkrafttreten der DSGVO zum 25.5.2018, insoweit aufgegeben.
Vieles ist in der Rechtsprechung der unteren Instanzen jedoch noch ungeklärt; daher erscheint eine richtungsweisende Entscheidung des Bundesgerichtshofs, sogar besser noch des Europäischen Gerichtshofs, dem schlussendlich das letzte Wort zukommen wird, nunmehr auch wünschenswert.
Vielleicht nicht explizit, so aber doch indirekt, wird der BGH am 15.6.2021 auch dazu Stellung nehmen, was Versicherungsgesellschaften bislang vehement ablehnen, ob das „Recht auf Kopie“ aus Art. 15 Abs. 3 DS-GVO nun auch eine Art pre-trial-discovery nach US-amerikanischem Vorbild bedeutet. Die Zivilprozesslehre lehnt dieses Institut bislang überwiegend ab; gerade im Verhältnis zu Großkonzernen kann die discovery jedoch zur „prozessuale Waffengleichheit“ für Verbraucher gewiss dienlich sein.
Nachdem die Rechtsprechung irgendwann die Reichweite des Anspruchs aus Art. 15 Abs. 3 i.V.m. Art. 4 Nr. 1 und 6 DS-GVO geklärt hat, werden sich die Stretigkeiten freilich nicht vollständig erledigen, sondern auf die Gegenrechte der verantwortlichen Stelle und Dritter aus Art. 15 Abs. 4 DS-GVO verlangern.
Aber dieses ist eine andere Geschichte, die ein anderes Mal erzählt weden soll.
Stand: 28.04.2021