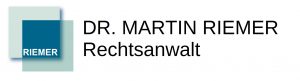Rechtsanwälte und ihre Richter
Worin besteht in publizistischer Hinsicht der Unterschied zwischen Rechtsanwälten und Richtern? Wer als Rechtsanwalt einen (wissenschaftlichen) Beitrag veröffentlicht, äußert damit lediglich seine „Privatmeinung“. Welche Außenwirkung diese entfaltet, ob und wer von ihr überzeugt wird, ist ungewiss, zumal in einer Zeit, in der über elektronische Medien und ein zunehmendes Angebot an Fachzeitschriften mehr geschrieben wird, als je zuvor.
Gerichte allerdings, wenn sie Entscheidungen verkünden, haben es nicht nötig, Überzeugungsarbeit für die Richtigkeit ihrer Auffassungen zu leisten: Richter sprechen durch ihr Urteil (vgl. Uwe Kranenpohl: Hinter dem Schleier des Beratungsgeheimnis, 2010, S.454). Sie brauchen nichts zu kommentieren und zu rechtfertigen, sondern können sich auf die staatliche Autorität ihres Rechtsprechungsmonopols berufen. Urteilen sie zwar stets im Einzelfall, so werden ihre Rechtsansichten doch für gewöhnlich verallgemeinert (sog. Präzedenzurteile). Jeder frisch ins Amt gelangte Proberichter einer Eingangsinstanz vermag auf diesem Weg nachhaltiger zu wirken, als seine ihn kürzlich zuvor noch unterrichtenden Lehrmeister an den Universitäten.
Ein Rechtsanwalt, der rechtspolitisch wirken möchte, erreicht daher mehr, wenn er sich nicht in die Schlange der Autoren einreiht, die auf die Annahme ihrer Beiträge durch die Schriftleitungen der Verlage warten, sondern ein Gericht dazu bewegt, einen streitigen Sachverhalt in seinem Sinne zu begutachten, um dieses sodann der Veröffentlichung zuzuführen. Sollte das Urteil „falsch“ sein bzw. nicht auf Zustimmung stoßen, vermag seine Bekanntgabe gleichwohl einen gewichtigen Beitrag zur Fortbildung des Rechts zu leisten, indem es in den einschlägigen Fachkreisen zu Diskussionen führt.
Ein Gerichtsurteil, ganz gleich welchen Gerichts, führt jedenfalls zu mehr Außenwirkung und Beachtung, als eine bloße Literaturstimme – und wird über Suchmaschinen des Internets und Datenbanken regelmäßig auch schneller veröffentlicht.
In medias res: Einige Kritikpunkte zur Anwaltsgerichtsbarkeit und deren Auswirkungen auf das materielle anwaltliche Berufsrecht.
1. Anwaltsgerichtsbarkeit und ihre Nähe zur Exekutiven
Im System der Anwaltsgerichtsbarkeit wird derzeit Reformbedarf erkannt. Rennert (AnwBl. 2014, 905) und Quaas (AnwBl. 2015, 330) zeigen mit diskussionswürdigen Ansätzen auf, dass verwaltungsrechtliche Anwaltssachen besser angegliedert an die Verwaltungsgerichtsbarkeit aufgehoben sein könnten, als in der Nähe zu Oberlandesgerichten. Ob dies für ein liberales, zukunftsorientiertes Berufsrecht günstiger wäre, sollte damit letztinstanzlich nicht der Bundesgerichtshof, sondern das Bundesverwaltungsgericht über Anwaltsangelegenheiten entscheiden, erscheint hingegen ungewiss: Verwaltungsrichter haben in Personalangelegenheiten für gewöhnlich mit Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu tun und könnten von Rechtsanwälten leichthin (unbewusst) erwarten, sich als solche zu verhalten.
Die anwaltlichen Richter an den Anwaltsgerichten und Anwaltsgerichtshöfen werden gem. §§ 94 Abs.2, 103 Abs.2 BRAO von den jeweiligen Landesjustizministern auf Vorschlag der Rechtsanwaltskammern ernannt. Eine andere Möglichkeit, in die Richterämter zu gelangen, als über die Vorschlagslisten der RAK-Vorstände, besteht nicht. Allein bereits schon dieser Umstand begründet die Besorgnis, dass die in jenen Gerichten tätigen Rechtsanwälte im Streitfall eine gesteigerte Nähe zu den Kammervorständen und ihren – als Terminsvertretern fungierenden – Geschäftsführern mitbringen, mit denen sie aufgrund langjähriger Bekanntheit eng verbunden sind (und deswegen schließlich wohl vorgeschlagen wurden). Eine Änderung hin zu mehr Mitbestimmung der Anwaltschaft insgesamt bei der Auswahl ihrer Richter könnte zwar darin liegen, wie bei den Mitgliedern der Satzungsversammlung zukünftig unmittelbar wählen zu lassen, wer den Justizministern für die Richterämter vorgeschlagen werden soll, wobei sich auch hier jedoch wiederum einflussreiche Gruppen wie z. B. regionale Anwaltvereine, aufgrund ihres guten Organisationsgrades, Wählerstimmen zu mobilisieren, mit ihren Interessen durchsetzen könnten.
Eine Stärkung der Unabhängigkeit der Anwaltsgerichtshöfe könnte jedenfalls darin liegen, dass in verwaltungsrechtlichen Anwaltssachen die Geschäftsverteilungspläne vorsehen, dass jene Rechtsanwälte als Richter nicht mitentscheiden dürfen, die aus eben den Bezirken stammen, in denen der Streit entstanden ist: So könnte vermieden werden, dass die beklagte Rechtsanwaltskammer ein zu großes Näheverhältnis zu den Entscheidern der Streitfälle unterhält.
2. Vertretung durch Sozietäten der Richter-Kollegen
Tatsächlich kann es passieren, dass sich Rechtsanwaltskammern vor den Anwaltsgerichtshöfen – anstelle von ihren Geschäftsführern, wie man es bei der öffentlichen Verwaltung erwarten darf (arg ex §§ 112 c Abs.1 BRAO, 67 Abs.2 und 4 VwGO) – durch Kanzleien vertreten lassen, denen als Sozietätsmitglied ein amtierender Richter des zur Entscheidung berufenen Anwaltsgerichtshofs angehört (So die Problematik im Verfahren AnwGH Hamm 2 AGH 26/12, vgl. Beschluss vom 12.4.2013). Hierdurch entsteht leichthin der Eindruck, dass zwischen Richtern und Rechtsanwaltskammern „die Schreibtische zu eng zusammenstehen“. Ungeachtet der Frage, ob § 67 Abs.5 VwGO aufgrund seiner Verweisung in § 112c Abs.1 BRAO dieses überhaupt gestattet (offen gelassen in AnwGH Hamm 2 AGH 26/12, Urteil vom 8.11.2013, und BGH AnwZ(Brfg) 82/13, Beschluss vom 12.3.2015), wenn der Briefkopf der Sozietät der RAK-Prozessbevollmächtigten diesen Anwaltsrichter führt, sollte unter den AGH-Richtern ein Ehrenkodex etabliert werden, der solches ausschließt. Andernfalls könnte auch hierdurch die Besorgnis begründet werden, dass sich die Senate in der Verlegenheit sehen könnten, nicht zum Nachteil einer Sozietät eines ihrer Kollegen zu entscheiden.
3. Anwaltsgerichte in Abhängigkeit von Rechtsanwaltskammern
Im Disziplinarrecht vor den Anwaltsgerichten besteht die Besonderheit, dass nur Entscheidungen zurückgehend auf Anschuldigungen durch Generalstaatsanwaltschaften noch von einer höheren Instanz überprüft werden können, nicht aber Beschlüsse über Rügebescheide des Kammervorstandes. Was aber, wenn der zugrundeliegende Streit sedes materiae grundsätzliche Bedeutung hat und das Anwaltsgericht über den Einspruch gegen eine Rüge zu entscheiden hat. Eine mögliche Fehlentscheidung eines Anwaltsgerichts, als gleichwohl nicht mehr angreifbares Präjudiz, mag das Berufsrecht dann ggf. in eine falsche Richtung lenken.
Anwaltsgerichte unterhalten gem. § 98 Abs. 1 und 2 BRAO eine Geschäftsstelle, deren erforderliche Bürokräfte, Räume und Arbeitsmittel durch die Rechtsanwaltskammer zur Verfügung gestellt werden. Welche Funktion haben Anwaltsgerichte? U. a. Rügebescheide des Kammervorstandes in Verfahren nach § 74 a BRAO zu überprüfen. Diejenige staatliche Stelle, die überprüft werden soll, stellt also die Sach- und Personalmittel für die darauf gerichtliche richterliche Tätigkeit. Welchen Protest würde es vom Standpunkt der Gewaltenteilung wohl hervorrufen, würden die Strafgerichte ihre Sach- und Personalmittel von den Staatsanwaltschaften oder die Verwaltungsgerichte von den Regierungspräsidien beziehen? Wie blind kann Justitia unter diesen Umständen sein? Ein besseres Fundament für Neutralität wäre, die Anwaltsgerichte komplett in die ordentliche Gerichtsbarkeit einzugliedern und unabhängig von den Rechtsanwaltskammern aus den Landeshaushalten zu finanzieren.
4. Anfechtbarkeit von Beschlüssen einer Kammerversammlung
Der Anwaltsgerichtshof Hamm (Urteil 2 AGH 26/12 vom 8.11.2013) und der Bundesgerichtshof (Urteil AnwZ(Brfg) 82/13 vom 12.3.2015) hatten sich mit der Frage zu befassen, ob und inwieweit Beschlüsse der Mitgliederversammlung gerichtlich anfechtbar sind, worüber es in zurückliegenden Jahren immer mal wieder Streit gab. Dem lag als Ausgangskonflikt zugrunde, dass bei der beklagten Rechtsanwaltskammer eine lange Tradition bestand, dass die jährlichen Versammlungen (§ 89 BRAO) von Kammermitgliedern dominiert wurden, die dem Kammervorstand eher unkritisch gegenüberstanden, da sie im Grunde „immer wieder von denselben“ Stimmenmehrheiten beherrscht wurden: Rechtsanwälte, die zugleich bei den drei örtlichen Anwaltvereinen aktiv waren, wobei diese Anwaltvereine nicht nur geringe finanzielle Zuwendungen aus dem Kammerhaushalt erfuhren. Haushaltsvorlagen wurden „abgeschmust“; eine kritische Kontrolle der Verwendung der Finanzmittel durch den Kammervorstand seitens der Mitgliederversammlung fand faktisch nicht statt, was nach Bekanntwerden erstaunlicher Unregelmäßigkeiten ein anhaltendes Misstrauen über die Lauterkeit der Mittelverwendung zur Folge hatte, sodass schließlich der in der Kammerversammlung getroffene Beschluss zur Festsetzung des Mitgliedsbeitrages und zur Entlastung des Kammervorstandes zusammen mit den Wahlen zum Kammervorstand gerichtlich angefochten wurde. Gerügt worden war insbesondere, dass der Kammerhaushalt anstelle von unabhängigen „Kassenprüfern“, wie sie in den Satzungen eingetragener Vereine selbstverständlich sind, lediglich von einer WP-Gesellschaft überprüft wurde: Diese konnte jedoch nur die rechnerische Richtigkeit und stichprobenartig den Bestand von Ausgabenbelegen überprüfen, nicht jedoch, ob der Vorstand zweckgebundene Pflichtbeiträge zur Finanzierung eines Karnevalsempfangs im ersten Hotel der Stadt aufwendete.
Der AnwGH Hamm und der Bundesgerichtshof haben die Anforderungen an die Zulässigkeit einer solchen Klage jedoch so hoch gehängt, dass sie praktisch unerreichbar sind: Es gibt offenbar Abhaltungen in der Anwaltsgerichtsbarkeit, die damit verbundene Arbeit, Beschlüsse einer Kammerversammlung gerichtlich nachzuprüfen, nicht schultern zu wollen: Steht dieses Ziel fest, lässt sich juristisch immer auch ein Weg finden, die für die Klage notwendige Beschwer des Klägers in eigenen Rechten hinwegzuargumentieren.
Hierzu stellt sich die Frage, ob der vom BGH bestätigte restriktiver Umgang zur faktisch nicht bestehenden gerichtlichen Nachprüfung von (Haushalts-)Beschlüsse einer Kammerversammlung der Selbstverwaltung eher schadet als nützt. Der „Versammlung der Kammer“ obliegt gem. § 89 Abs.2 Nr. 6 BRAO u. a., „die Abrechnung des Vorstandes über die Einnahmen und Ausgaben der Kammer sowie über die Verwaltung des Vermögens zu prüfen und über die Entlastung zu beschließen“. Die Mitgliederversammlung als solche kann diese Aufgabe, einen Etat von mehreren Millionen Euro zu hinterfragen, binnen der wenigen Stunden ihres jährlichen Zusammentretens jedoch faktisch bereits nicht leisten. Ihr fehlt zum einen der Einblick in die Bücher der Geschäftsstelle und zum anderen die Zeit für eine eingehende Prüfung, gerade auch im Hinblick darauf, ob die Ausgaben des Vorstandes und der Geschäftsführer sich strikt auf den gesetzlichen Zuständigkeitsbereich der berufsständischen Kammer beschränkt haben. Wer fremde Gelder verwalten und ausgeben darf, unterliegt nun einmal der (nur zu menschlichen) Versuchung, seinen Aufgabenbereich weit zu verstehen, Freunde und Gönner als „Verwaltungshelfer“ oder gar „Beliehene“ zu beauftragen, sich als „Mäzen“ zu gerieren. § 89 Abs.2 Nr.6 BRAO überträgt der Mitgliederversammlung somit eine Aufgabe, die sie nur dann erfüllen könnte, wenn ihr unabhängige Kassenprüfer, die umfassend Zugang zur Buchhaltung der Geschäftsstelle haben und insbesondere die Mittelverwendung prüfen können, vor Beschlussfassung berichten würden. Solche Funktionsämter schreibt die BRAO bedauerlicherweise bislang jedoch nicht vor. Allein bereits die Präsenz von „Kassenprüfern“, wie jeder Sportverein sie kennt, die Gefahr, „entdeckt zu werden“, die bei einer bloßen WP-Gesellschaft als Überwachungsinstrument deutlich geringer ist, würde die notwendige Disziplin im Umgang mit den Mitgliederbeiträgen bereits befördern.
5. Einstellungen bei Rüge- und Anschuldigungsverfahren
Liest man zu § 74a in den BRAO-Kommentierungen nach, findet sich dort durchgehend die Meinung, dass Verfahren über Anträge auf anwaltsgerichtliche Entscheidungen zur Überprüfung von Rügebescheiden nicht gem. §§ 153, 153a StPO eingestellt werden können, weil die Verfahrensvorschriften der StPO zu Opportunitätserwägungen im Rügeverfahren keine Rolle spielten (Vgl. Hartung in: Henssler/Prütting, BRAO, 4.Aufl. 2014, §74a Rn. 20; Kleine-Cosack, BRAO, 7.Aufl. 2015, §74a Rn.4; Weyland in: Feuerich/Weyland, BRAO, 9.Aufl. 2016, § 74a Rn.30; Lauda in: Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltliches Berufsrecht, 2.Aufl. 2014, § 74a Rn.12). In zwei Fällen hat das AnwG Köln gleichwohl genau solche Verfahrenseinstellungen beschlossen, was Zustimmung verdient. Das Antragsverfahren vor dem Anwaltsgericht dient zwar der Überprüfung, ob der RAK-Vorstand das Verhalten eines Kammermitglieds zutreffend „gerügt“ hat. Der Rechtsgedanke der §§ 153, 153a StPO, auch wenn diese Vorschriften auf eine Ermessensentscheidung des Gerichts unter Mitwirkung der Beteiligten hinauslaufen, kann jedoch – jedenfalls in Ausnahmefällen – auch auf Berufsrechtsverstöße und nicht lediglich auf Straftaten und Ordnungswidrigkeiten Anwendung finden. Z. B., wenn das Rüge- und/oder Gerichtsverfahren bereits überlange gedauert hat oder der Sachverhalt unverhältnismäßig kompliziert aufzuklären wäre. Die überlange Dauer eines Gerichtsverfahrens begründet ungeachtet der §§ 198 ff. GVG einen Verstoß gegen den dem Rechtsstaatsgebot des Art. 20 GG ausfließenden Anspruch auf ein faires Verfahren (der zugleich auch in Art. 6 EMRK verbürgt ist). Da der Rechtsanwendungsbefehl des Art. 1 Abs. 3 GG auch die Anwaltsgerichte in die Pflicht nimmt, haben diese in jedem Stadium des Verfahrens zu prüfen, ob wegen etwaiger überlanger Verfahrensdauer, wie das AnwG Köln sie in beiden Fällen angenommen hat, die Verfahrensfortsetzung noch zumutbar ist.
6. Unterentwickelte Veröffentlichungskultur
Da uneingeschränkt jede BGH-Entscheidung zur Veröffentlichung gelangt, werden auch alle Urteile des Anwaltssenats der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Prüft man Juris – als die nach wie vor größte juristische Urteilsdatenbank – hingegen darauf ab, wie viele Urteile und Beschlüsse der Anwaltsgerichtshöfe und Anwaltsgerichte das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben, fällt die Bilanz eher nüchtern aus. Von 1994 – 2015 finden sich dort 731 Einträge zu AGH-Entscheidungen und von 1995 – 2015 gerade einmal 96 zu solchen von Anwaltsgerichten. Da Juris im gleichen Zeitraum bereits über 2000 AnwZ-Entscheidungen des BGH auflistet und gewiss nicht in allen Streitfällen Rechtsmittel eingelegt werden, muss die Zahl der veröffentlichungsfähigen Ausgangsentscheidungen deutlich höher gelegen haben. Den anwaltlichen Berufsgerichten fehlt jedoch offenbar der Elan, ihre Entscheidungen zu publizieren, obgleich dies in Zeiten heutiger Datenbanken doch recht einfach wäre. Sie unterhalten nicht einmal eine eigene Homepage, auf denen sie ihre Geschäftsverteilungspläne veröffentlichen.
7. Wählbarkeit zu Ämtern der Selbstverwaltung bei Anschuldigungsverfahren
Nicht für ein Vorstandsamt wählbar ist, wer einen der Ausschlussgründe des § 66 BRAO verwirkt hat. Gem. § 66 Nr.1 BRAO genügt hierfür schon, dass ein anwaltsgerichtliches Verfahren „eingeleitet“ wurde, ungeachtet dessen, ob es später zu einem Freispruch oder gem. § 114 Abs.1 Nr.1 BRAO lediglich zu einer „Warnung“ führte, die für sich keinen Verlust der Wählbarkeit zur Folge hätte. Gem. § 121 BRAO wird das anwaltsgerichtliche Verfahren jedoch bereits durch die bloße Einreichung einer Anschuldigungsschrift durch die Generalstaatsanwaltschaft eingeleitet, d. h. im Zeitpunkt des Eingangs dieser Schrift beim Anwaltsgericht entfällt zwingend und unabdingbar das passive Wahlrecht. Diese Einschränkung ist deutlich strenger als für die Wahlen zu Volksvertretungen (vgl. u. a. § 13 Bundeswahlgesetz), was die Frage nach dem Grund dieser Strenge aufwirft und auch gefährlich sein kann: Möchte die Generalstaatsanwaltschaft ein bestimmtes Vorstandsmitglied oder gar den RAK-Präsident zur Wiederwahl verhindern, brauchte sie lediglich vor den Wahlen eine Anschuldigungsschrift gegen ihn einzureichen, und zwar so kurzfristig, dass das Anwaltsgericht gem. § 131 BRAO die Eröffnung der Hauptverhandlung nicht (rechtskräftig) ablehnen kann. Da die Generalstaatsanwälte gem. § 146 GVG der Weisungsgebundenheit durch die Landesjustizminister unterstehen, könnte auch ein Justizminister oder Staatssekretär auf die Idee kommen, einem Widersacher im RAK-Amt „eins auszuwischen“, was sich mit Unabhängigkeit der Selbstverwaltung nicht verträgt. Besser wäre daher eine Modifizierung bzw. Streichung des § 66 Nr.1 BRAO, um eine Einmischung der Landesjustizverwaltung in die Selbstverwaltung in der Form zu verhindern, dass sie z. B. einen rechtspolitisch engagierten (und ggf. „unbequemen“) Rechtsanwalt auf dem Weg über eine Anschuldigungsschrift kurz vor den Vorstandswahlen kurzerhand „kaltstellt“.
8. Übertragbarkeit von Aufgaben des Kammervorstands auf „Beauftragte“
Lässt man den Blick verträumt ins Gesetz schweifen, findet sich in § 79 BRAO, dass die laufenden Geschäfte einer Rechtsanwaltskammer durch das Präsidium geführt werden (sollen), welches „die Geschäfte des Vorstandes, die ihm durch dieses Gesetz oder durch Beschluss des Vorstandes übertragen werden“ (§ 79 Abs.1), erledigt, welches über „die Verwaltung des Kammervermögens“ (§ 79 Abs.2) beschließt und welches wiederum gem. § 78 Abs.1 BRAO von den Mitglieder des Vorstandes „aus seiner Mitte“ gewählt wird, und zwar alsbald nach dessen Konstituierung (§ 78 Abs. 4). Das RAK-Präsidium besteht gem. § 78 Abs.2 BRAO aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, dem Schriftführer und dem Schatzmeister, wobei die Zahl der Präsidiumsmitglieder vom Vorstand weiter – beliebig – erhöht werden kann (§ 78 Abs.3).
Die Realität jedoch sieht anders aus. Die täglichen Verrichtungen einer Rechtsanwaltskammer („Geschäfte“) werden nicht von gewählten Vorstandsmitgliedern, sondern von „RAK-Geschäftsführern“ erledigt, bei denen es sich lediglich um „leitende Verwaltungsangestellte“ handelt, denen weitere – nachgeordnete – Verwaltungsmitarbeiter der Kammergeschäftsstelle zugeordnet sind und weisungsgebunden zuarbeiten. RAK-Geschäftsführer werden arbeitsvertraglich vom Präsidium eingestellt und nicht von der Kammerversammlung gewählt, die bei ihrer Bestellung – unbeachtet der faktisch hohen Bedeutung dieser Ämter – auch kein Mitspracherecht besitzt. Sie zeichnen „i.A.“ und zuweilen auch „i.V.“, mit – mangels gesetzlicher oder satzungsrechtlicher Grundlage – unklarer Berechtigung ihrer Vertretungsmacht, wobei sie als Hauptamtliche gewiss über den Vorteil verfügen, dass sie das Berufsrecht durchweg besser beherrschen, als die lediglich ehrenamtlich tätigen und auf Zeit gewählten Vorstandsmitglieder, deren Hauptberuf in den Kanzleien liegt. Da die Bundesrechtsanwaltsordnung die Funktion von „Kammergeschäftsführern“ jedoch nicht vorsieht, ist bislang ungeklärt, inwieweit der Vorstand bzw. das Präsidium Entscheidungswalt in Disziplinar- und Verwaltungsangelegenheiten auf angestellte Kammergeschäftsführer übertragen und diesen eigenständige Entscheidungen überantworten darf. Z. B. die verbindliche Beantwortung von Mitgliederanfragen zu berufsrechtlich relevantem Verhalten, über Beschwerden, zur Anrechenbarkeit von Fortbildungsleistungen nach der FAO, bei Streitfragen in Ausbildungsverhältnissen, Abgabenmitteilungen an die Generalstaatsanwaltschaften etc.. Das Vakuum, das die Abwesenheit der gewählten Vorstandsmitglieder von den RAK-Geschäftsstellen bedingt, führt zu rechtsfreien Räumen für die Kammergeschäftsführer. Sollte ein Mitglied lediglich von einem RAK-Geschäftsführer beschieden werden, hat es unter Verweis auf § 79 BRAO auf Antrag jedenfalls einen Anspruch darauf, dass sich – je nach weiterer ggf. satzungsrechtlicher Ausgestaltung der Zuständigkeiten – entweder das Präsidium, eine Vorstandsabteilung oder aber der (Gesamt)Vorstand mit seinem Anliegen befasst.
Dass es einer Rechtsanwaltskammer nicht gestattet ist, ihrer hoheitlichen Aufgaben nach dem Berufsbildungsgesetz, die gem. § 71 Abs.4 BBiG als „zuständige Stelle“ ihr obliegen, auf Anwaltvereine und/oder „Ausbildungsbeauftragte“ zu übertragen, wurde gerichtlich hingegen bereits entschieden (vgl. BGH AnwZ(Brfg) 67/12, Urteil v. 10.3.2014; vorgehend AnwGH Hamm 2 AGH 24/11, Urteil . 7.9.2012).
Vorstehende Problempunkte wurden anhand von Erfahrungen aus berufsrechtlichen Rechtsstreiten erkannt (der Autor war jeweils verfahrensbeteiligt). Bei einer Überarbeitung der Anwaltsgerichtsbarkeit sollte de lege ferenda insbesondere der Frage nachgegangen werden, wie der Einfluss der Rechtsanwaltskammern bei der Besetzung der Berufsgerichte mit „unabhängigen“ Richtern, die nur ihrem Gewissen unterworfen sind (und sich nicht jenen Stellen verpflichtet sehen brauchen, die sie für ihre Ämter vorgeschlagen haben), minimiert werden kann. Durch eine jeweils eigene Internetpräsenz erführen die Anwaltsgerichte und Anwaltsgerichtshöfe jedenfalls die Möglichkeit, Entscheidungen mit grundsätzlicher Bedeutung unabhängig von den Redaktionen der lokalen RAK-Mitteilungsblätter vorzustellen und für eine bessere „Sichtbarkeit“ dieser Gerichte in der Öffentlichkeit zu werben.
Stand: 12.03.2017