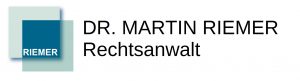Anmerkung zum Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts 6 B 15.20 vom 07.04.2020
Der Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts verdeutlicht eine grundsätzliche Schwachstelle der Verwaltungsgerichtsordnung. Anders als im Zivilprozess, wo nach Eintritt eines erledigenden Ereignisses eine (rechtsmittelfähige) Kostenentscheidung gem. § 91a ZPO ergeht, die zu begründen ist, sieht § 161 Abs. 2 VwGO keine Begründungsnotwendigkeit vor, sondern nur eine billige Kostenentscheidung.
Es kommt nicht nur im Einzelfall vor, dass sich entweder in erster oder zweiter Instanz Verwaltungshandeln als unrechtmäßig erweist. Die Verwaltung erfährt sodann jedoch die „Gnade“ seitens des Verwaltungsgerichts, dass dieses seine Rechtsauffassung darlegt und der Beklagten anheimstellt, die erforderlichen prozessualen Veranlassungen nachzuholen. Kommt die Verwaltung dem nach, entfällt das Rechtsschutzbedürfnis für die Klage, um welche Klageart auch immer es sich handeln mag. Der Beklagtenseite wird im Verwaltungsgerichtsprozess auf diesem Weg eine Niederlage erspart bzw. ermöglicht, sich gesichtswahrend aus dem Verfahren zurückzuziehen, indem sie schlussendlich diejenige Handlung vornimmt, zu der sie von Anfang an verpflichtet war.
Den klagenden Bürger bringt dies in eine missliche Situation. Gibt er daraufhin eine Erledigungserklärung ab, hat das Verwaltungsgericht nur noch über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden, wobei diese Kostenentscheidung unanfechtbar ist und einer Begründung nicht bedarf. Es kommt im Einzelfall auch vor, dass der klagende Bürger zwar Recht hatte und dies durch die späteren Hinweise des Verwaltungsgerichts und die faktische Erfüllungshandlung der Verwaltung nach Rechtshängigkeit auch belegt ist. Gleichwohl überbürdet ihm das Gericht – aus Gründen, die er nie erfahren wird – die Kosten des Rechtsstreits auf.
Zuweilen besteht jedoch nicht nur ein Bedürfnis, den vorliegenden Einzelfall vor Gericht zu tragen, sondern auch, eine Präzedenzentscheidung zu erstreiten. Dafür ist die Verwaltungsgerichtsordnung jedoch denkbar ungeeignet bzw. wurde bewusst so gefasst, dass dies nur unter äußerst erschwerten Bedingungen möglich ist. Gibt der Kläger nämlich die Erledigungserklärung nicht ab, sondern stellt die Klage auf Fortsetzungsfeststellungsklage um, gelingt ihm dies nur unter den Voraussetzungen, dass er als Fortsetzungsfeststellungsinteresse weiterhin Schadensersatzansprüche verfolgen könnte, eine Wiederholungsgefahr droht, er ein Rehabilitationsinteresse hat oder ein tiefgreifender und unerträglich schwerer Grundrechtseingriff vorlag. Alle vier Kriterien werden von der Rechtsprechung jedoch äußerst eng ausgelegt, sodass sie höchst selten erreicht werden können. Weder der Gesetzgeber noch die Verwaltungsgerichte schätzen Fortsetzungsfeststellungsklagen. Der Gesetzgeber wollte ganz gezielt verhindern, dass Präzedenzentscheidungen gegen die Verwaltung ergehen, welche diese in zukünftigen Fällen binden könnten. Die Verwaltungsgerichte schätzen es angesichts ihrer ständigen Überlastung, wenn sie statt eines Fortsetzungsfeststellungsurteils lediglich einen unbegründeten Kostenbeschluss absetzen brauchen.
Man könnte auch sagen: Unter der bestehenden VwGO kommt die Verwaltung „billig davon“. Sie lässt sich einfach verklagen und ca. zwei Jahre später, wenn die überlasteten Verwaltungsgerichte erstmals dazu kommen, die Sache mündlich zu terminieren, erklären sie in der Hauptverhandlung aufgrund der richterlichen Hinweise ein Anerkenntnis, wobei gegen sie anders als gem. § 307 ZPO im Zivilprozess kein Anerkenntnisurteil ergehen kann. Die Verwaltung kann so gesehen „nie verlieren“, wenn sie dies nicht möchte. Sie kann sich stets über eine Anerkennung der Klageansprüche aus dem Verfahren davonschleichen, ohne das ein veröffentlichungsfähiges Urteil ergeht, solange der Bürger nicht ein überzeugendes Interesse (Fortsetzungsfeststellungsinteresse) darlegen kann, den Rechtsstreit über diesen Zeitpunkt hinaus noch fortzuführen.
Zuweilen besteht jedoch das Bedürfnis, genau ein solches Urteil – gegen alle Widerstände; vor allem des Verwaltungsgerichts – dennoch zu bekommen, um zumindest aufzeigen zu können, wer bis zum Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses im Recht war und um sich für zukünftige Fälle davor zu schützen, dass die Exekutive ihr streitgegenständliches Verhalten wiederholt. Der Bürger erreicht dies nur, wenn er auf Fortsetzungsfeststellungsklage umstellt, denn nur so bringt er das Verwaltungsgericht zumindest in die Rolle ähnlich eines Notars, der in dem Fortsetzungsfeststellungurteil den Verlauf der vorgerichtlichen und gerichtlichen Auseinandersetzung protokolliert, auch wenn es dann im Tenor auf Klageabweisung entscheidet und dem Kläger die Kosten überbürdet. Er kann auf diesem Weg zumindest eine veröffentlichungsfähige Entscheidung herbeiführen, aus der hervorgeht, dass er zumindest bis zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung Recht hatte und sich dies auch zukünftig wieder so verhalten wird.
Dass ihm gleichwohl die Kosten auferlegt werden, ist zwar ärgerlich. Hierfür müsste die Verwaltungsgerichtsordnung jedoch an einer empfindlichen Stelle geändert werden, was die Verwaltung auf dem Weg ihrer Einflussnahme auf den Gesetzgeber zu verhindern wissen wird. Als Trostpflaster beleibt jedoch, dass die Kosten vor dem Verwaltungsgericht gemeinhin deutlich geringer ausfallen, als in der Zivilgerichtsbarkeit, da die allermeisten Rechtsstreite nach dem Auffangstreitwert von 5.000 Euro gem. § 52 Abs. 2 GKG bemessen werden, woran sich der Streitwertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit orientiert. Kosten für die Verwaltung treten regelmäßig kaum auf, da sich diese durch verbeamtete oder angestellte Volljuristen in den Verfahren selber vertritt und allenfalls die Reisekosten als Auslagen zur Kostenerstattung angemeldet werden können. Außerdem bewegen sich die erstinstanzlichen Gerichtskosten bei einem Streitwert vom 5.000 Euro gerade mal bei 438 Euro für drei GKG-Gebühren gem. KV 1210, sodass klagende Bürger, die an einem gerichtlichen Urteil gleichwohl interessiert sind, es eher verkraften werden, diese vergleichsweise geringen Kosten eines verwaltungsgerichtlichen Rechtsstreits abzuschreiben, als auf eine Sachentscheidung zu verzichten.
Im vorliegenden Fall war der Versuch unternommen worden, die vier vorbezeichneten Kriterien der Fortsetzungsfeststellungsklage (Schadensersatzinteresse, Wiederholungsgefahr, tiefgreifender Grundrechtseingriff oder Rehabilitationsinteresse) um einen fünften Aspekt zu erweitern, indem der Rechtsgedanke aus dem Entschädigungsrecht bei überlangen Gerichtsverfahren aus § 198 Abs. 4 S. 1 GVG herangezogen wurde, der eine „Wiedergutmachung auf andere Weise“ ermöglicht. Weder das Oberverwaltungsgericht Münster, noch das Bundesverwaltungsgericht sind diesen Weg jedoch mitgegangen, indem sie sich auf das formale Argument zurückgezogen haben, dass es in der VwGO keine Regelungslücke gebe, welche eine analoge Anwendung von § 198 GVG gestatte.
Dies ist im Ergebnis zwar vertretbar. Das Bundesverwaltungsgericht vergibt mit dieser Rechtsprechung jedoch die Chance, den Kanon der bestehenden vier ausschließlichen Fallgruppen für das Fortsetzungsfeststellungsinteresse zu erweitern bzw. an heutige Gegebenheiten anzupassen. Rechtsstreite, nicht nur, aber auch in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, dauern immer länger. Wenn es der Verwaltung gestattet wird, durch die Verweigerung rechtmäßigen Verhaltens den Bürger nicht selten Jahre lang von seinen Rechten zu entfremden, ihr dann jedoch gleichwohl das Schlupfloch offengehakten wird, es sich bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung noch anders überlegen zu dürfen und das Klageinteresse damit zu vernichten, bleibt ein schaler Geschmack zurück.
Materielle Gerechtigkeit erstreckt sich nicht nur auf den Einzelfall; sie muss das übergeordnete Ziel jeden Gerichtsverfahrens und Urteilsspruchs bleiben. Vor dem Hintergrund des vorliegenden Beschlusses sollte rechtspolitisch darüber nachgedacht werden, dass Fortsetzungsfeststellungsinteresse ganz allgemein zu erweitern und auch auf solche Fallgruppen zuzulassen, in denen der Kläger schlicht und ergreifend lediglich ein Interesse an der Entscheidung aus Präzedenzgründen vorträgt.
Manche mögen einwenden, dass die Verwaltungsgerichte hierdurch weiter in eine schon jetzt nicht mehr zu bewältigende Arbeitsbelastung hineingetrieben würden. Andere mögen diese Idee ablehnen, weil sich der VwGO-Prozess damit zu einer Objektivierung des Rechtsschutzes hin verschieben würde, was die Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Judikative in eine Schieflage bringen würde, wenn gegen die Verwaltung aus einer Art „Allgemeininteresse“ heraus objektive bzw. objektivierte Urteile ergingen, welche eine gewisse Präzedenzwirkung für zukünftige Fälle haben können.
Präzedenzentscheidungen strukturieren die Rechtsordnung in der heutigen Zeit nahezu genauso, wie Parlamentsgesetze. Sie werden jedenfalls in sehr ähnlicher Weile in Bezug genommen und zitiert. Die Verwaltung will dies jedoch augenscheinlich jedoch nicht und die Verwaltungsgerichte haben, wenn auch aus anderen Gründen, hieran ebenfalls kein übermäßiges Interesse. Es sollte somit darüber nachgedacht werden, die Fortsetzungsfeststellungklage mit allen anerkennungsfähigen Interessen zur Fortsetzung eines Rechtsstreits in der VwGO gesondert zu kodifizieren und verstärkt die Möglichkeit zuzulassen, Feststellungsentscheidungen auch für die Vergangenheit auszusprechen.